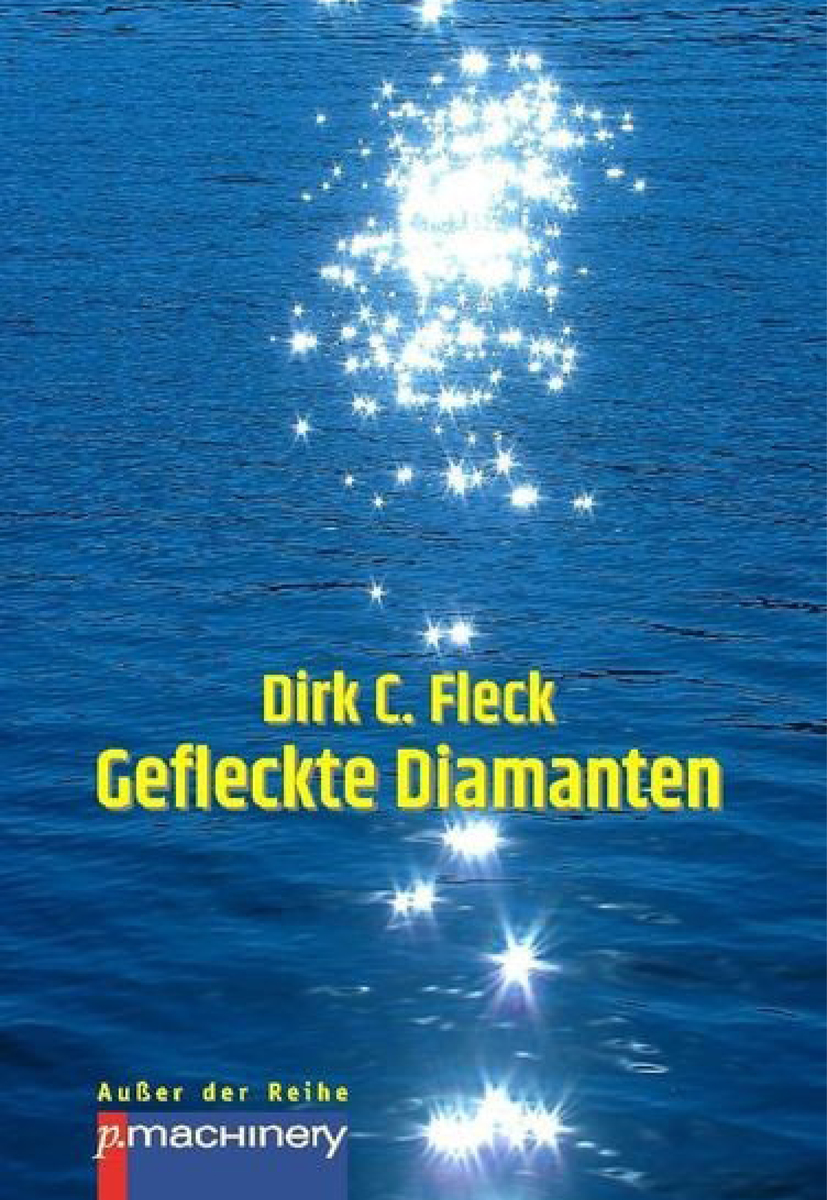Der Besuch in der Gedenkstätte Esterwegen, dem KZ, in dem Carl von Ossietzky inhaftiert war, wirkt nach. Gestern träumte ich, dass die Häftlinge nicht ins Moor, sondern an den Nordseestrand getrieben wurden, wo sie die anrollenden Wellen mit ihren Schaufeln ins Meer zurückwerfen mussten. Dieser Traum versinnbildlicht die Perversion der Macht noch mehr, als es die Bilder aus Warschau vermögen, wo Juden gezwungen wurden, den Gehweg mit der Zahnbürste zu säubern.
Niemand wird den Charakter des Windes aufgrund einer einzigen Berührung erkennen. Ebenso wenig lässt sich aus dem Sturz des Wassertropfens die Kraft und Dynamik eines Wasserfalls ablesen. Alles, wir eingeschlossen, ist flüchtiger Ausdruck eines fließenden großen Ganzen.
Also keine Festlegungen auf beeindruckende Details. Die Aufgabe des Künstlers besteht darin, das isoliert Sterbliche in den Zusammenhang des unendlichen Lebens hinüberzuführen (Franz Kafka). Wer die Geduld dafür aufbringt, zahlt mit einer gehörigen Portion Einsamkeit. Vielleicht gehören solche Menschen deshalb zu den ersten Anwärtern auf die Gnade.
Melancholie ist das tiefe Verständnis für die Ästhetik der Traurigkeit.
Ich fühle mich wie ein verirrter Schmetterling über den Gletschern eines gläsernen Gebirges.
„Man kann die Erfahrung nicht früh genug machen, wie entbehrlich man in der Welt ist“, hat Goethe gesagt. Es ist gut, sich rechtzeitig bewusst zu machen, welch unbedeutende Rolle wir im Theater des Lebens spielen und wie faszinierend es ist, dass sich nach jeder Vorstellung der Vorhang des Vergessens schließt, damit sich die neue Inszenierung nicht im Gestrüpp alter Weltanschauungen verheddert.
Mit den Jahren stellt sich bei der Betrachtung der Welt eine gewisse Müdigkeit ein.
Nicht nur das, was wir tun, sondern auch, was wir denken und fühlen, steht mit allen anderen Taten, Gedanken und Gefühlen sämtlicher Mitwesen auf diesem Planeten in ständiger Verbindung und bedingt einander, sodass aus diesem Konglomerat der jeweils augenblickliche Zustand der Welt erwächst. Je mutiger unser Handeln, je klarer und gerechter unsere Gedanken und je tiefer unsere Gefühle, desto mehr tragen wir dazu bei, dass sich die „Gesamtlage“ zum positiven verändert.
Irrtümer sind Weichensteller. Wir brauchen sie, solange wir vom jugendlichen Wahnsinn getrieben durchs Leben toben.
Vor dem Hintergrund der Zeit, die unendlich ist, und eines Raums, der unendlich ist, ist die Größe, die der Mensch sich anmaßt, lächerlich. Wir sind einem Ozean entsprungen, der Tropfen in die Sonne wirft. Und einer dieser Tropfen sind wir. Wir wissen jedoch, dass wir zurückfallen werden in dieses unendliche Meer, wo wir der Identität wieder verlustig gehen. Dass kann Angst machen. Aus dieser Angst heraus entstehen die Machtstrukturen in unserer Gesellschaft.
Es gibt Enttäuschungen, die im Nachhinein als heilsam empfunden werden. Wer dieses Prinzip erkennt, ist auch nicht mehr beleidigt dem Leben gegenüber, wenn es ihm vermeintlich nicht wohlgesonnen ist.
Ich möchte mir die Tage ausziehen wie ein schmutziges Hemd, ich möchte der Mann sein, der seinen Kopf durch das Himmelszelt steckt und verzückt in unbekannte Welten blickt.
Meine Gedanken sind kraftlos geworden, sie bewegen nichts mehr. Die Welt bleibt keck vor ihnen stehen, ein wenig blöd, ein wenig banal, ein wenig dreckig. Die Goldadern der Sehnsucht sind versiegt, und so glotzen wir uns an, die Plastikgans vom Balkon gegenüber und ich. Immerhin: Meine Unzufriedenheit ist gestillt, aber ich bin nicht einmal mehr zur Trägheit fähig.
Das ruhige, stetige Wirken der Natur hat bisher noch jeden hysterischen Versuch, sich an den Gesetzen der Schöpfung vorbeizumogeln, eingeholt und befriedet.
Ob Düfte, Gefühle oder Bilder — alles ist permanent in Fluss. Die Konstante, das, was uns in diesem Strudel wirklich erdet, liegt auf dem Grund. Es ist die Essenz des Lebens, sein eigentlicher Geschmack.
Mir kann nichts mehr passieren, ich sterbe bald.
„Es ist wirklich unglaublich, wie nichtssagend und bedeutungsleer, von außen gesehen, und wie dumpf und besinnungslos, von innen empfunden, das Leben der allermeisten Menschen dahinfließt“, notierte Arthur Schopenhauer (1788 bis 1860). „Es ist ein mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode, unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken.“
Mit einer solchen „Verfügungsmasse“ lässt sich natürlich trefflich Politik betreiben.
Wenn das Ego einen schönen Moment erfährt, verlangt es sofort nach einer Fortsetzung.
Er fühlte sich wie ein Stein im Wasser, der zu Boden sinkt, um dort seinen elementaren Beitrag im Sediment zu leisten.
Am Boden zu sein, heißt auch, Wurzeln schlagen zu können.
Die Tat ist nicht das Leben, sondern ein Instrument zum Absaugen von Energien.
Kein Glück will etwas mit Befriedigung zu tun haben.
Ein fahrlässig provozierter Tod ist wie eine plötzliche Inflation, in der alles Ersparte auf einen Schlag dahin ist.
Das Opfer-Täter-Verhältnis wird nach unserem Ableben in eine große Gerechtigkeitsschale geworfen.
Ich taumele jeden Tag zwischen Leben und Tod.
Ich frage mich, was mein Leben ist. Manchmal scheint es ausgegangen, selten vergangen oder gegenwärtig, eher wie etwas, das ich erst noch machen muss.
Unsere Sinneseindrücke, an denen wir das Leben ablesen, bilden eine Schutzschicht gegen die Wahrheit. Diese Schicht wird mit zunehmendem Alter dünner, bis sie schließlich eine Art Jungfernhäutchen darstellt, das jeden Moment reißen kann. Ist dies der Tod?
Bei manchen Menschen weiß niemand, ob sie eine reiche Innenwelt verbergen oder die absolute Leere.
Die Tragödie der Philosophen: Sie können sich nicht aussuchen, wann sie die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist ein Tyrann.
Ich glaube alles, was du mir sagst, aber ich weiß, dass alles anders ausgehen wird. Du bist ein Stern, ein Stein, den man in die Waagschale wirft, ein Richter mit verbundenen Augen, eine Grube, in die man stürzt, ein Weg, ein Kreuz und ein Pfeil. Bis jetzt wanderte ich in Gegenrichtung zur Sonne: Von nun an bekenne ich mich zu zwei Geschlechtern, zwei Himmeln, zwei Hemisphären, von allem zwei. Von nun an will ich doppelgelenkig und doppelgeschlechtlich sein. Alles, was geschieht, wird zweimal geschehen. Ich werde wie ein Gast auf dieser Erde sein, ich werde weder dienen noch dienen lassen. Ich werde das Ende in mir suchen.
Meine Gedanken wiegen manchmal zu schwer für die Sätze, die sie ins Außen transportieren sollen.
Wenn ich mich, was allerdings immer seltener geschieht, auf eine Diskussion einlasse oder auch nur auf ein Gespräch unter Bekannten, rede ich unvernünftig und wirr, wie meine Gesprächspartner nicht müde werden zu betonen. Dass erschreckt mich, denn immer wenn dieser Vorwurf erhoben wird, bin ich der Meinung, besonders überzeugend gewesen zu sein. Wirr. Oder auch verworren, chaotisch, konfus, unübersichtlich, verwickelt, durcheinander. Das Substantiv von wirr ist übrigens Wirrnis, es ist feminin, was mich ein wenig beruhigt. Es wird mit Verworrenheit im Denken in Bezug gebracht, die wiederum nur dem Wirrkopf zu eigen ist, der seiner Wirrsal erliegt, also dem Wahnsinn schlechthin, welcher für alle Tragödien und Mythen der Weltliteratur unabdingbar war. Im Gegensatz zu meinen Mitmenschen muss ich aus diesem Napf einige Löffelchen zu viel zu mir genommen haben, anders ist das Unverständnis nicht zu erklären, auf das die meisten meiner Worte inzwischen treffen.
Vorahnung.
Ich fühle mich ausgehöhlt, nichts gereicht mir zur Stärkung. Aber ich bin nur Gast in dieser Landschaft der gefrorenen Dämmerung. Nichts scheint sie zu bewegen, es ist, als habe das Universum sie ausgeschieden. Und wir, die wir in ihr verhaftet sind, fühlen uns abgenabelt von den Impulsen des Lebens. Wir toben in diesen verlorenen Tagen herum wie Maden in einem Zeitkadaver. Unsere Gedanken und Bewegungen zehren lediglich an der verbliebenen Restenergie. Bald wird es zur Panik kommen.
In meinen Träumen ist Platz für die gesamte melancholische Bandbreite des Lebens.
Ich möchte die Kapuze des Schlafes über diese Tage werfen, in denen sich nichts zu regen scheint. Die Bewegungen in den Straßen gerinnen zu statischen Linien einer in den Winter gebannten Grafik der Trostlosigkeit. Selbst der Schlaf, den ich finde, ist ganz sich selbst überlassen: wie eine Reaktion auf ein nicht geschriebenes Buch. Es fehlt ihm die Würze inspirierender Träume. Sie meiden mich, und schon bleibt nichts übrig von mir. Ich bin wie ein Resonanzboden inmitten des großen Schweigens.
Wir alle leben unsere Defizite, die umso mehr werden, je verzweifelter wir nach Erfüllung suchen, egal welcher Art.
„Ich bin ein Hungernder geworden, ich leide unter einem entsetzlichen Mangelzustand des ganzen Wesens, das von nichts anderem als von quälender Leere erfüllt ist. Von dem Flehen, dass, wo nichts war, etwas sein möge. Dieses Fieber, dieses Elend, das mich wachhielt, dieses Gefühl, dass mir nun zeitlebens etwas vorenthalten wird, macht mich krank. Ich suche nach der Wahrheit hinter den Dingen und stehe stets mit leeren Händen da.“
Das schrieb Amélie Nothomb in ihrem beeindruckendem Buch „Biographie des Hungers“. Auch ich komme mir vor wie ein Kieselstein, der bei Erdarbeiten von einem Schaufelbagger vor sich hergeschoben wird, nutz- und orientierungslos.
Meine Weihnachtstränen sind stille Tränen, sie sammeln sich rund um die Pupillen, bis sie über die Lider treten und das Gesicht mit einem kühlen Film benetzen, während die Augen, ohne zu zwinkern, wie benebelt ins Nirgendwo blicken. Kein Schluchzen stört die geschenkte Andacht, der Körper verharrt erschütterungslos, als sei er ein Flugobjekt, das den Geist durch die Weiten des Universums trägt, wo endlich Frieden herrscht … Einmal im Jahr, Heiligabend nämlich, kann ich mich auf diese Begegnung der dritten Art verlassen. Ich nähere mich diesem Moment in Ehrfurcht, allerdings muss ich dafür alleine sein. Zwischen siebzehn und achtzehn Uhr schalte ich das Radio an, NDR 2. Um diese Zeit senden sie deutsche Weihnachtslieder. Die klassischen, mit Chor. Ich sitze auf dem Fensterbrett und schau über die Straße auf das gegenüberliegende Haus. Ein Altbau mit großen Fenstern, in der die Bewohner wohl übereingekommen sind, auf Gardinen und Jalousien zu verzichten, sodass man in die geschmückten Wohnzimmer blicken kann, in denen Kaminfeuer brennen und Weihnachtsbäume glitzern. Dann kommen die Kinder und reißen die Pakete auf, sie hüpfen ihren Eltern in die Arme und die Hunde bellen dazu. Und jetzt passiert es: Aus dem Radio erklingt „Stille Nacht, heilige Nacht“, geschrieben von dem Hilfspfarrer Joseph Mohr (Text) und dem Dorfschullehrer und Organisten Franz Xaver Gruber (Musik), die ihr Lied am Heiligabend 1818 in der Schifferkirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg erstmals aufführten. In der 6. Strophe heißt es dann: „Christ der Retter ist da!“. Dies ist der Augenblick, wo die Tränen über die Lider treten und mein Gesicht fluten.
Ein Vorschlag, den ich, so ich denn König von Deutschland wäre, jedem meiner Mitbürger dringend empfehlen würde, ist die Spiegel-Abstinenz. Damit meine ich nicht das Druckerzeugnis (das auch), ich meine die wirklichen Spiegel, die überall aushängen, in der eigenen Wohnung wie auch draußen.
Stellen Sie sich vor, wir würden uns selbst dazu verpflichten, eine Woche pro Monat jeden Blick in den Spiegel zu meiden. Wie die Tiere, ja. Ohne unser Spiegelbild würden wir uns völlig neu sehen. Die Eitelkeit fiele von uns ab, wir würden uns unserem wahren Wesen wieder annähern. Wie erholsam. Und was wir dann dermaßen befreit an positiver Energie in die Gesellschaft tragen, würde sie liebens- und lebenswerter machen, garantiert. Aber ich bin nun mal nicht der König von Deutschland, dessen Wort Gewicht hätte …
Was immer aus der Vergessenheit steigt, sucht nach einer Stimme.
Epilog
Gestern Nacht hatte ich den Eindruck, mich am Rande des Lebens zu bewegen, dort, wo unseren Gedanken und Gefühlen Grenzen gesetzt sind — wo sie sanft gegen eine Wand fluten, die ohne Farbe und ohne Konsistenz ist. Ich habe mich tastend an ihr entlang bewegt und nach einem Ausgang gesucht.
Hier können Sie das Buch bestellen: Thalia

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem Dauerauftrag von 2 Euro oder einer Einzelspende unterstützen.
Oder senden Sie einfach eine SMS mit dem Stichwort Manova5 oder Manova10 an die 81190 und mit Ihrer nächsten Handyrechnung werden Ihnen 5, beziehungsweise 10 Euro in Rechnung gestellt, die abzüglich einer Gebühr von 17 Cent unmittelbar unserer Arbeit zugutekommen.