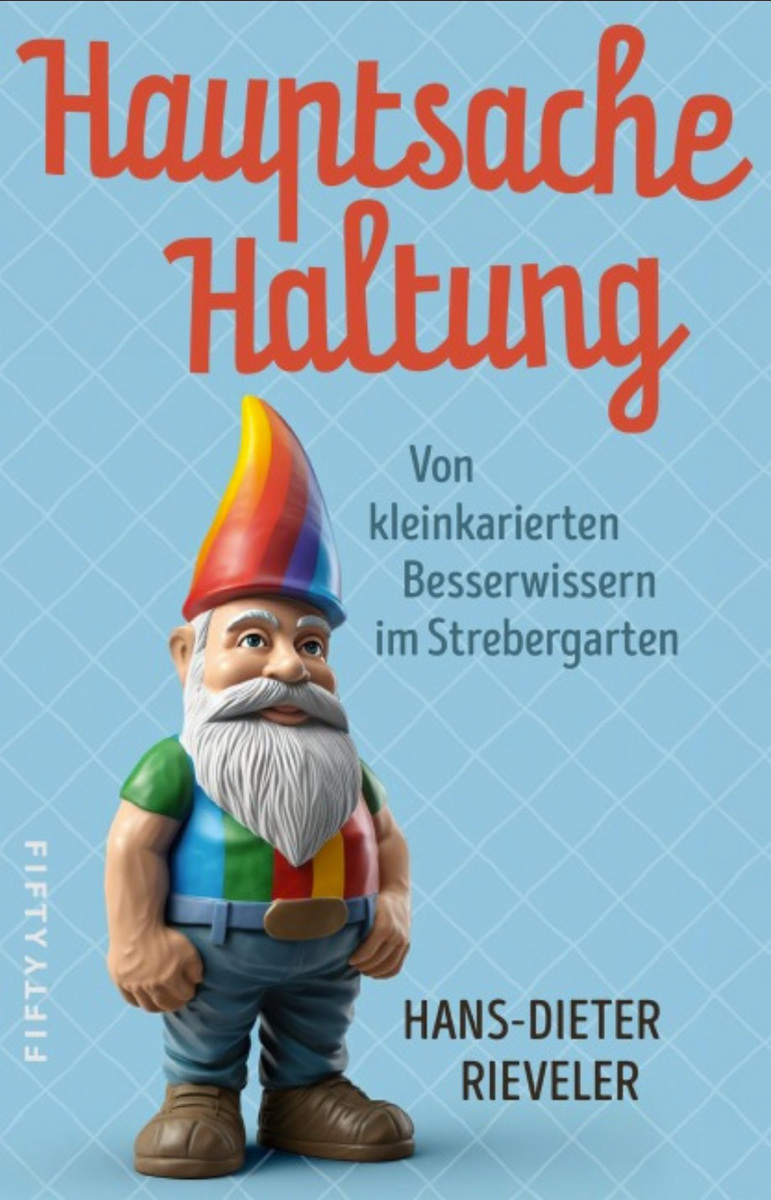Beim Kampf um die Deutungshoheit stehen die Medien an vorderster Front. Als Gatekeeper wachen sie darüber, welche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen und in welcher Form und in welchem Umfang darüber berichtet wird. Neben den vermeintlichen Interessen der Medienkonsumenten berücksichtigen Journalisten bei solchen Entscheidungen auch persönliche Präferenzen, ob bewusst oder unbewusst. Daher ist es für die sogenannten Progressiven ein Segen, dass sich eine neue Generation identitätspolitisch geschulter Pseudolinker auf den Marsch durch die Institutionen begeben hat.
Sie studieren Gender Studies, Postcolonial Studies oder andere Geistes- und Sozialwissenschaften, in denen inzwischen ebenfalls oft postmoderne Ansätze dominieren. Vor allem junge Menschen, die sich selbst gerne reden hören und mit ihren Diskursen die Welt verbessern wollen, drängt es dazu, solche Fächer zu studieren, deren Vertreter sich wenig für die Realität interessieren, sie aber unbedingt verändern wollen. „Und intellektuell schwächere Leute haben natürlich die starke Neigung, in solche Fächer zu gehen und dort Glaubensstärke zu beweisen“, sagte der Politologe Herfried Münkler im Gespräch mit dem Spiegel-Journalisten René Pfister (1). Nach dem Studium drängen viele der solcherart geschulten jungen Leute in die Medien oder in den boomenden Diversity-Sektor, wo Nichtregierungsorganisationen, der öffentliche Dienst, aber auch Privatunternehmen sie mit offenen Armen empfangen (2).
Die Nachwuchsjournalisten, die in die Redaktionen aufrücken, sind größtenteils „progressiv“ gesinnt und stammen aus den besseren Kreisen der Gesellschaft. Eine Befragung der 150 Volontäre von ARD und Deutschlandradio im Jahr 2020 ergab, dass 57 Prozent den Grünen zuneigten, 25 Prozent der Linken. 60 Prozent waren weiblich, und 30 Prozent hatten einen Migrationshintergrund.
Neben einem Volontariat bei den Öffentlich-Rechtlichen bietet die Ausbildung an einer der renommierten Journalistenschulen die besten Karriereaussichten. Mit der sozialen Herkunft der Journalistenschüler befasste sich Klarissa Lueg in ihrer im Jahr 2011 abgeschlossenen Dissertation an der Technischen Universität (TU) Darmstadt. Der Frauenanteil lag bei 63 Prozent. 68 Prozent gehörten der höchsten Herkunftsgruppe an, 17 Prozent der gehobenen, 15 Prozent der mittleren und 0 Prozent der niedrigen Herkunftsgruppe (3). Zu der letzteren rechnete Lueg kleine Angestellte, Facharbeiter oder Beamte des einfachen und mittleren Dienstes. Damit war die soziale Zusammensetzung der Journalistenschüler noch deutlich elitärer als die der bereits im Beruf stehenden Journalisten (4). In kaum einem anderen Berufsfeld ist die soziale Selektion (…) größer als im Journalismus.
Doch nicht nur in den Medien, auch an den Hochschulen, im Kulturbetrieb und in der evangelischen Kirche geben zunehmend jüngere „Progressive“ aus gutem Hause den Ton an. Darüber hinaus können besonders die Grünen auf die Unterstützung unzähliger Verbände, Vereine, Stiftungen und Bürgerinitiativen zählen. Zusammen bilden diese die sogenannte Zivilgesellschaft.
Der Begriff geht auf die englische Bezeichnung „civil society“ zurück. Im engeren Sinne versteht man darunter Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die Einfluss auf die Politik zu nehmen versuchen, im weiteren Sinne jegliche nichtstaatlichen Zusammenschlüsse von Bürgern, die nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, kurz gesagt: den dritten Sektor neben Staat und Markt.
Demnach gehörten Kegelvereine, Bürgerinitiativen gegen den Bau von Windrädern oder der Verein Deutsche Sprache ebenso zur Zivilgesellschaft wie die Deutsche Umwelthilfe, Trans-Verbände oder Antifa-Gruppen. Da die Zivilgesellschaft in der Theorie aber die Demokratie stützen soll, zerbrechen sich Sozialwissenschaftler bis heute den Kopf darüber, wie man die gute von der bösen Zivilgesellschaft unterscheiden kann. Weit sind sie dabei nicht gekommen, da es keine neutrale Instanz gibt, die objektiv darüber entscheiden könnte.
In den linksliberalen Medien macht sich darüber jedoch kaum jemand einen Kopf. Munter wird der Begriff Zivilgesellschaft nicht im beschreibenden, sondern im normativen Sinne verwendet. Wenn irgendwo „gegen rechts“ demonstriert wird, heißt es, die Zivilgesellschaft habe Haltung gezeigt.
Dass es im Osten Deutschlands mehr Rechtsextreme als im Westen gibt, wird darauf zurückgeführt, dass die Zivilgesellschaft dort zu schwach ausgebildet sei. Wenn Umweltschutzverbände zusammen mit kirchlichen Organisationen ein Positionspapier veröffentlichen, in dem sie für „gerechte und nachhaltige Wasserstoffimporte“ eintreten, dann nennen sie es „Forderungspapier der deutschen Zivilgesellschaft zur Wasserstoff-Importstrategie“ (5). Und wenn der Paritätische, die Arbeiterwohlfahrt, Brot für die Welt, Terre des Hommes und allerlei andere Organisationen ihre Forderungen zur Migrationspolitik kundtun, dann nennen sie dies „Bericht der deutschen Zivilgesellschaft für das International Migration Review Forum“ (Hervorhebung durch den Verfasser)(6).
Umstritten ist indes, wer dazugehört und welche Rolle die Zivilgesellschaft im demokratischen Gefüge einnehmen soll. Angesichts der Debatten um Postdemokratie und Politikverdrossenheit sowie des Erstarkens des Rechtsextremismus hoffen manche, dass zivilgesellschaftliche Organisationen die Demokratie quasi von innen heraus reparieren, indem sie den Bürgern die richtigen Haltungen einimpfen. Nur wer entscheidet darüber, welche Haltungen die richtigen sind?
Schauen wir uns dazu ein Beispiel aus der Praxis an. Zusammen mit weiteren Berlinern Bürgern wandte sich der Historiker Götz Aly gegen die geplante Umbenennung der Mohrenstraße. Grüne und SPD hatten in der Bezirksverordnetenversammlung Mitte unter Verzicht auf jede Bürgerbeteiligung dem Druck von Aktivisten nachgegeben. Ihre Begründung für die Umbenennung lautete: „Nach heutigem Demokratieverständnis ist der bestehende rassistische Kern des Namens belastend und schadet dem internationalen Ansehen Berlins (Hervorhebung durch den Verfasser).“ Entgegen der üblichen Vorgehensweise in solchen Fällen gab es keine Informationsveranstaltungen oder die Möglichkeit, Namensvorschläge einzureichen. 1.134 Bürger legten daraufhin Widerspruch gegen den Umbenennungsbeschluss ein. Da das Bezirksamt ihnen mit einer Verwaltungsgebühr von bis zu 741,37 Euro drohte, zogen die meisten ihre Widersprüche zurück. 237 blieben standhaft, überwiesen die am Ende auf 148,27 Euro reduzierte Gebühr und erhielten ein standardisiertes Ablehnungsschreiben.
Der Berliner Zeitung sagte Aly, das Bezirksamt Mitte verstoße mit seinem Vorgehen gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, indem es zwar Aktivistengruppen mit anti- oder postkolonialer Ausrichtung als „zivilgesellschaftliche Akteure“ anerkenne, nicht aber jene Bürger, die gegen die Umbenennung „begründete Einwände erheben“. Diese seien nach Ansicht des Bezirksamts „offensichtlich nicht als gleichrangige oder überhaupt als zivilgesellschaftliche Akteure“ zu betrachten (7).
„Nach heutigem Demokratieverständnis“ entscheiden eben die Regierenden, welche Aktivistengruppen zur Zivilgesellschaft zu zählen sind und welche nicht. Wer dazu zählt, darf nicht nur mit Wertschätzung, sondern auch mit üppigen finanziellen Zuwendungen rechnen.
Hier können Sie das Buch bestellen: Buchkomplizen

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem Dauerauftrag von 2 Euro oder einer Einzelspende unterstützen.
Oder senden Sie einfach eine SMS mit dem Stichwort Manova5 oder Manova10 an die 81190 und mit Ihrer nächsten Handyrechnung werden Ihnen 5, beziehungsweise 10 Euro in Rechnung gestellt, die abzüglich einer Gebühr von 17 Cent unmittelbar unserer Arbeit zugutekommen.
Quellen und Anmerkungen:
(1) Pfister, René: Ein falsches Wort. Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht. München 2022, Seite 102.
(2) Vergleiche ebenda, Seite 105 folgende.
(3) Lueg, Klarissa: Habitus, Herkunft und Positionierung. Die Logik des journalistischen Feldes. Wiesbaden 2012 (zeitgleich Dissertation TU Darmstadt 2011), Seite 69.
(4) Von den im Beruf stehenden Journalisten entstammen laut einer Studie von Siegfried Weischenberg aus dem Jahr 2006 rund 67 Prozent der Mittelschicht. Als Angehörige der „Mittelschicht“ wurde allerdings auch Personen erfasst, die nach Luegs Klassifizierung zur gehobenen oder mittleren Kategorie zu rechnen wären (ebenda).
(5) https://www.germanwatch.org/sites/default/files/forderungspapier_h2-importstratgie.pdf, abgerufen am 23. Mai 2024.
(6) https://www.fes.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=72960&token=b91e2834518ca358044db6ca18c58b008647d165, abgerufen am 23. Mai 2024.
(7) Tkalec, Maritta: „Götz Aly gegen das Bezirksamt Mitte.“ In: Berliner Zeitung, 3. Juli 2023, Seite 9.