Uupa wartete schon vor der Kathedrale, obwohl Cording auf die Minute pünktlich war. Sie marschierten geradewegs zum Hafen. In dem ehemaligen Touristenpavillon bei den Fähranlegern befand sich jetzt eine Telefonzentrale für Ferngespräche. Cording nutzte die Gelegenheit und bat Uupa um etwas Geduld. Er ließ sich mit Hamburg verbinden, er wollte Mike zumindest kurz von der eigenartigen E-Mail berichten, die ihnen gestern untergekommen war. Eine Sekretärin teilte ihm mit, dass Herr Kühling als kommissarischer Leiter der Chefredaktion in London zu erreichen sei. Also versuchte er es dort. Im Londoner Büro sagte man ihm, dass sich Mike in einer Besprechung befand, also beschloss Cording, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen.
Vom Quai d’honneur wies Uupa auf die vorgelagerte Insel Motu Uta, die mit Papeete durch einen Damm verbunden war. Ursprünglich diente sie als Quarantäne-Station, bis man sie in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zum Benzinlager umfunktioniert hatte. Von den gigantischen, schneeweiß gestrichenen runden Tanks, die früher kilometerweit ins Auge stachen, fehlte jetzt jede Spur. Das gesamte Areal war begrünt worden und erinnerte mit seinen jungen Kokospalmen an eine Parklandschaft.
„Beim Abbau der Tanks hatte es einen Unfall gegeben“, sagte Uupa. „Man hatte vergessen, einen der Behälter leer zu pumpen. Als die Abrissbagger ans Werk gingen, ergossen sich tausende Tonnen Schweröl ins Meer. An den Folgen leiden die benachbarten Strände noch heute.“
„Wie gut, dass Tahitis Strände sowieso schwarz sind“, entfuhr es ihm.
Er hätte wissen müssen, dass seine stramme Begleiterin keinen Sinn für derlei derbe Späße hatte. Cording fragte sich, wieso er es trotzdem nicht lassen konnte. Es gab Menschen, die einen förmlich zu Sticheleien provozierten, man wünschte eben hinter die Fassade zu schauen. Uupa war so ein Mensch. Ihre Art des persönlichen Umgangs widersprach allen Erfahrungen, die Cording bisher auf Tahiti gemacht hatte.
„Haere tu! Haere tu!“
Er trottete an der Seite seiner Führerin über die neue Uferpromenade. Wieder fielen ihm die Veränderungen auf, die sich in Papeete während der letzten Jahre vollzogen hatten. Die Menschen wirkten heiterer und gelassener, als er es in Erinnerung hatte. Irgendjemand musste das Ventil geöffnet und den Überdruck abgelassen haben. Nicht nur die Architektur hatte sich verändert, sondern auch die Räume zwischen den Häusern, die vor einigen Jahren noch mitten im Verkehrsfluss standen, der bis in die letzten befahrbaren Winkel strömte. Heute waren die Nebenstraßen begrünt, als hätte der Dschungel sich von den dunklen Bergen ins Tal ergossen.
„Das Verkehrsproblem haben wir durch Dezentralisierungsmaßnahmen in den Griff bekommen“, sagte Uupa. „Früher musste fast jeder Tahitianer täglich nach Papeete fahren. Hier war ja alles versammelt: die Verwaltung, die Schulen, die Shoppingcenter. Achtzig Prozent aller Arbeitsplätze befanden sich in der Hauptstadt. Der Hafen und der Flughafen wirkten ebenfalls als Magnete. 200.000 Autos steuerten die Stadt täglich an. Hintereinander gereiht ergibt das eine Strecke, die anderthalb Mal um die Insel reicht. Durch die Auslagerung eines großen Teils der öffentlichen Einrichtungen, durch die Dezentralisierung der Geschäfte und vor allem durch den Reva-Tae bekommt Papeete wieder Luft. Die Grundversorgung findet jetzt auf dem Lande statt.“
Cording deutete auf einen wuchtigen, fast vierzig Meter hohen Pfeiler im Meer, der die Aussicht auf Mooreas Silhouette grässlich entstellte. „Was ist das?“, fragte er.
„Es handelt sich um den letzten noch abzubauenden Pylon einer zwei Kilometer langen Brücke, über die bis vor fünf Jahren der Umgehungsverkehr an Papeete vorbei geleitet wurde.“
„Das habt ihr euch gefallen lassen?“
„Nein“, antwortete sie, „das siehst du doch.“
Der Boulevard Pomare war um eine Fahrspur verengt und zu beiden Seiten mit Kokospalmen bepflanzt worden. Die Kräne, das ganze Baugerät, welches dahinter in Stellung gebracht worden war, konnte er von dieser Seite nur erahnen. Das frühere Tiaré Hotel, ehemalige Anlaufstation für alle, die nach Mitternacht eingeflogen wurden, lag in Trümmern. Die Banque de France auch. Das Postgebäude war um zwei Stockwerke gekappt. Die ganze Häuserfront war auf einer Linie zurechtgestutzt worden. Lediglich die protestantische Kirche von Paofai Siloama durfte sich darüber hinaus erheben.
„Bei uns darf kein Haus mehr höher sein als eine ausgewachsene Kokospalme“, hörte er Uupa sagen, als könnte sie Gedanken lesen. Sie überquerten die Straße. „Alles was du hier siehst, jedes Bauwerk, ist aus natürlichen Rohstoffen gefertigt.“
Schwang da Stolz in ihren Worten? Sie dozierte nicht, sie sprach plötzlich wie ein menschliches Wesen.
„Für die Wände benutzen wir Hanfbeton* oder Lehm*, die Dächer sind aus Pandanus* und die tragenden Säulen aus Holz oder Bambus*.“
Sie fasste ihn bei der Hand und führte ihn über einen kleinen Steg ins Innere eines Rohbaus.
Er hatte als Student auf einem Rohbau gejobt, dort stank es erbärmlich nach feuchtem Mörtel und chemischen Harzen. Dieser Bau hingegen duftete. Nicht gerade wie eine Parfümerie, eher wie ein gehobener, noch erdverklebter Schatz. In seinen Mauern konnte man frei atmen, hier legte sich kein Gipsstaub auf die Bronchien. Es war das erste Mal, dass es Cording angenehm war, sich den Geschmack des Fortschritts auf der Zunge zergehen zu lassen. Uupa informierte ihn darüber, dass die Renovierungen am Boulevard Pomare bald abgeschlossen sein würden. Nach hinten hin, in Richtung der Berge, sei aber noch eine Menge zu tun. Doch die Tahitianer liebten den Umbau ihrer Insel und arbeiteten gerne mit. Seitdem das Programm beschlossen worden war, herrschte Vollbeschäftigung auf Tahiti.
Bevor sie auf ihren Vorschlag hin die Markthalle aufsuchten, zeigte sie ihm die Abrissarbeiten am Rathaus, das 1990 erbaut worden war, aber wegen gravierender Materialfehler schon kurze Zeit später wieder aufgegeben werden musste.
„An dieser Stelle“, sagte Uupa stolz, „wird eine Nachbildung jenes Palais entstehen, den Königin Aimata Pomare ab 1860 bewohnte.“
Auf dem Weg zum Markt ertappte sich Cording dabei, wie er den noch unangetasteten Bausünden der Vergangenheit gedanklich zu Leibe rückte, wie er hier eine Mauer eintrat, dort einen Supermarkt verschwinden ließ und jede Menge Tiefgaragen mit Erde auffüllte. Es machte Spaß, sich als Stadtplaner zu betätigen ...
Uupa eilte als erstes zu den Fischen, als sie die Markthalle betraten. Blau und hellgrün schimmernde Schuppen auf Eis. Sie wog das eine oder andere Exemplar in ihren Händen und ließ sich schließlich zwei Auhopu einpacken.
„Die Deckenformation, sämtliche Stahlträger und Eisentreppen — alles wurde entfernt und durch eine Holzkonstruktion ersetzt“, erklärte sie, während sie den Fisch in der Tasche verstaute.
Sie schob sich an einen Obststand, roch an der Brotfrucht, an Papayas und Pampelmusen. Nach und nach füllte sich ihr Enkaufsbeutel. Cording schien sie ganz vergessen zu haben. Als Uupa an den Blumenständen auf eine Freundin traf und die Tasche zum Plausch absetzte, stahl er sich davon. In diesem Gewusel konnte man einander schon mal aus den Augen verlieren ...
Das grelle Neonlicht im siebzehnten Stock lag der Verlagszentrale der Matlock Media Corporation wie ein Collier um den Hals. Die Blicke des Mannes, der sich in der verlassenen Straßenschlucht vor dem Canary-Wharf-Tower in den Docklands herumdrückte, glitten nervös zwischen den erleuchteten Fenstern der hohen Glasfassade und dem Haupteingang hin und her. Gelegentlich schaute er sich um. Auffälliger hätte man sich im Fokus der unzähligen Kameras, die jeden Quadratmeter der Londoner East Side überwachten, nicht benehmen können. Dabei ließ der zerknitterte Trenchcoat mit dem aufgeschlagenen Kragen und die tief in die Stirn gezogene Hutkrempe vermuten, dass der Herr am liebsten unsichtbar geblieben wäre. Unter seinem linken Arm trug er eine Aktentasche, die er mit beiden Händen fest umklammert hielt.
Als Mike Kühling durch die Drehtür ins Freie trat, drückte sich der Mann in den Schatten des gegenüberliegenden Hauses. Dann folgte er Kühling in gebührendem Abstand. Sie waren bei „Richmond“ verabredet. Der Fremde ging nicht gleich hinein, sondern zog es vor, die Lage durch den Schriftzug auf den Scheiben zu sondieren. Kühling stand an der Bar, begrüßte und wurde begrüßt. Chefredakteur von EMERGENCY zu sein bedeutete eben auch, den entsprechenden Umgang zu pflegen. Als Kühling endlich Platz genommen und wie verabredet eine Ausgabe der TIMES sowie das Januarheft von EMERGENCY neben sich auf den Tisch gelegt hatte, wischte sich der Mann eine Taubenfeder von der Schulter und trat ein.
Kühling bemerkte den seltsamen Kauz mit der kreisrunden, randlosen Brille sofort und auch den Herrschaften an der Bar war die eigenartige Gestalt nicht entgangen, die da zu den Toiletten schlich. Es dauerte geschlagene zehn Minuten, bis der Mann zurückkehrte und linkisch an Kühlings Tisch Platz nahm.
„Prof. Thorwald Rasmussen, nehme ich an“, sagte Kühling.
Sein Gegenüber nickte.
„Hören Sie“, raunte Rasmussen, „was ich Ihnen zu sagen habe, sprengt jedes Vorstellungsvermögen. In die Sache sind ganze Regierungen involviert. Und beileibe nicht irgendwelche! Aber bevor ich weiterrede, möchte ich eines gerne wissen: Welche Garantie habe ich, dass Sie das Material veröffentlichen und es nicht dem CIA übergeben? Ich weiß Bescheid über den Deal, der zwischen der Presse und den Geheimdiensten läuft.“
„Wie kann ich eine Garantie aussprechen, wenn ich nicht einmal weiß, wofür?“, fragte Kühling.
Prof. Rasmussen hatte die Tasche auf seinem Schoß fast vollständig unter sich begraben und er saß so gebeugt, dass sein hagerer Schädel knapp über der Tischplatte schwebte. Er blickte Kühling prüfend an. Nach wenigen Sekunden begannen sich seine Augen zu trüben, und sein Blick huschte nervös durch den Raum.
„Ich melde mich wieder“, sagte er plötzlich, erhob sich eilig und verschwand.
Kühling gab seine Bestellung auf und wusste nicht recht einzuschätzen, ob er es hier mit einem Verrückten zu tun hatte, oder ob er im Begriff war, einen der fettesten Fische an Land zu ziehen, die sich jemals im Netz von EMERGENCY verfangen hatten.
Steve schleuderte den Laptop aufs Bett und suchte nach dem Sicherungskasten. Die Stromversorgung war zusammengebrochen, er konnte den Akku seines Laptops nicht nachladen. Im schlimmsten Fall würde die erzwungene Auszeit seinen Rausschmiss aus dem Spiel bedeuten. Gerade hatte er ein weltweit gültiges Gesetz erlassen, das jeden mit dem Tode bestraft, der sich an einem der Umweltgesetze verging, die er in der letzten Sitzung formuliert hatte und die vom Expertengremium auch verabschiedet worden waren. Sein größter Erfolg bisher. Sein Einfluss auf die konkurrierenden Spieler, die sich ab jetzt an diese Gesetze zu halten hatten, war enorm gestiegen. Es klopfte an der Tür. Vor ihm stand der junge Tahitianer, der gelegentlich an der Rezeption arbeitete. Steve bat ihn hinein, aber sein Besucher blieb an der Türschwelle stehen.
„Mein Name ist Anapa“, sagte er fast entschuldigend. „Wir haben ein Computerproblem.“
„Ich weiß, geht mir genauso. Ich bin übrigens Steve, hallo. Wie lange wird es denn dauern, bis wir wieder Strom haben?“
Der Junge langte zum Lichtschalter. Als die Lampe über dem Flurspiegel aufzuckte, lächelte er scheu.
„Strom gibt es schon wieder. Aber der Stromausfall hat unseren Rechner zusammenbrechen lassen“, sagte er, „kannst du mal gucken kommen?“.
Steve schloss das Aufladegerät an die Steckdose und folgte dem Tahitianer widerstrebend durch den Garten zum Hauptgebäude.
Zwei Stunden hockte er mit der Taschenlampe unterm Tresen und checkte die Anschlüsse. Eine Zeitspanne, die er sich als Spieler kaum leisten konnte. Aber vielleicht war es ja gar nicht so schlecht, wenn er aus dem Game flog. Als die Anlage endlich ansprang, stellte er fest, dass sämtliche Dateien beschädigt waren. Er arbeitete sich durch die Rescueprogramme. Nach und nach begannen sich die Dokumente wieder aufzubauen. Zu Steves Belustigung begleitete Anapa jeden Erfolg mit einem polynesischen Veitstanz. Zum Schluss lagen sie sich triumphierend in den Armen.
„Kannst du surfen?“, fragte Anapa. „Auf den Wellen meine ich ...“
Steve schüttelte den Kopf.
„Dann musst du es unbedingt lernen! Du bist schließlich auf Tahiti! Meine Freunde und ich treffen uns morgen früh am Strand von Papenoo. Das sind nur fünfzehn Kilometer von hier. Ich hol dich ab. Um halb sechs wollen wir los!“
„Vergiss es, ich kann nicht“, antwortete Steve verlegen.
„Und warum nicht?“
„Weil ich spiele.“
„Warrior V.?“
Steve nickte.
„Ich war auch dabei. Bei acht Millionen und noch was bin ich eliminiert worden. An welcher Stelle stehst du jetzt?“
„Auf 347.“
„Irre“, staunte Anapa und legte Steve respektvoll die Faust auf die Brust. „Aber es wird Zeit, dass du mal raus kommst, Bruder, wir sehen uns morgen früh. Keine Widerrede!“
„Nein, wirklich nicht, das geht nicht ...“, entgegnete Steve und verschwand nach draußen in den Garten. Wieder einmal hatte der Spieler in ihm gesiegt.
Das hartnäckige Klicken in Steves Kopf fühlte sich an, als würden die Alpträume der Nacht in einem Mörser zerstampft. Trotz aller Anstrengung wollte es ihm nicht gelingen, die verklebten Lider voneinander zu lösen. Jemand rief seinen Namen. Und wieder dieses Klicken. Tacktacktack. Schemenhaft nahm er eine schlanke Gestalt wahr, die im Gegenlicht auf der Terrasse stand. Er öffnete die Schiebetür. Draußen stand Anapa, der ihn zu ihrem Surfausflug abholen wollte. Derart überrumpelt konnte Steve nicht mehr nein sagen. Er schlurfte ins Bad und blickte in den Spiegel, unter dem sich die Hibiskusblüten zusammengerollt hatten, die das Zimmermädchen gestern auf dem Waschbecken ausgelegt hatte. Die verschrumpelten Blumen korrespondierten gut mit seinem zerfurchten Bleichgesicht.
Nachdem er sich frisch gemacht hatte, meldete er in der Warrior-Zentrale Anspruch auf seinen Urlaubsjoker an. Vier freie Tage standen jedem Spieler im Laufe des Games zu, zwei davon nahm er jetzt. Als die Genehmigung erteilt war, folgte er Anapa zu dem pickup-ähnlichen Elektroauto, das auf sie wartete. Auf der Ladefläche scherzten zwei Tahitianer seines Alters mit einem etwa sechzehnjährigen Mädchen, das sich ihm als Fara vorstellte. Zur Begrüßung streckten sie ihm der Reihe nach die Fäuste entgegen. Er wusste nicht, wie er damit umzugehen hatte, bis sich das Mädchen seiner erbarmte, seine Hand nahm und ebenfalls zu einer Faust machte, die sie den anderen dann behutsam zuführte. Die kurzen Berührungen banden ihn auf magische Weise in den Kreis ein. Auf der Küstenstraße nach Papenoo hielt er den Kopf in den Wind und ließ sich die Restbestände von Müdigkeit aus dem Gesicht peitschen.
Anapa parkte den Wagen auf dem sandigen Seitenstreifen. Steve schwang sich als erster von der Ladefläche und nahm die Surfbretter entgegen, die man ihm reichte.
„Das Gelbe ist für dich“, sagte das Mädchen und sprang so behände wie eine Bergziege über die aufgetürmten Steinquader hinunter an den Strand. Die Jungs folgten ihr, nur Anapa blieb an seiner Seite. Steve war wie gebannt vom Anblick des Ozeans. Weit draußen zwischen den anrollenden Brechern machte er Dutzende von Köpfen aus, die wie Korken auf dem bewegten Wasser wippten. Was für ein gigantischer Spielplatz! Versehen mit einer schroff aufragenden kleinen Felseninsel, auf deren Plateau sich ein windschiefer Baum dem Land zuneigte. Das Mädchen paddelte durch den Schaumteppich den großen Wellen entgegen. Steve beobachtete, wie geschickt es die Tahitianer verstanden, ihnen auf den Kamm zu steigen, um sich dann in rasender Rutschfahrt bis zu dreißig Meter weit tragen zu lassen, bevor das Schaumgebilde über ihnen zusammenbrach.
Er folgte Anapa in das warme, türkisfarbene Wasser.
„Zieh die Flossen über“, mahnte sein neuer Freund, „auf dem Grund liegen jede Menge gut getarnter, giftiger Steinfische herum. Außerdem brauchst du sie, um schneller anpaddeln zu können — die Welle rollt sonst unter dir hinweg, noch bevor du überhaupt Fahrt aufnehmen kannst.“
Steve winkte ab und kehrte um.
„Ich geh da nicht rein“, rief er, „auf keinen Fall!“.
„Warum nicht?“, fragte Anapa. „Du musst heute noch nicht aufs Brett steigen. Wir haben dir das Bodyboard gegeben, darauf surft man im Liegen. Verletzen kannst du dich dabei auch nicht, weil es aus gepresstem Hanfschaum ist.“
Er band seinem ängstlichen Freund einen Klettverschluss ums Handgelenk, an dem eine Leine hing, die mit dem Surfbord verbunden war.
Steve nahm das Brett unter den Arm und stapfte neben Anapa ins Meer. Er vermochte sich in der seitlichen Strömung kaum auf den Beinen zu halten. Welche Wohltat war es, als er auf dem Surfbrett lag und von den wogenden Ausläufern der Brecher geschaukelt wurde. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit überkam ihn, aber dann stellte er erschrocken fest, dass er sich von Anapa entfernte. Gut zwanzig Meter lagen bereits zwischen ihnen. Er kämpfte sich mühsam zurück und schaute neidisch auf die Einheimischen dort draußen, die sich, sobald sie eine passende Welle ausgeguckt hatten, in Richtung Strand drehten, um sich dann blitzschnell aus dem schäumenden Weiß zu erheben. Wie Meeresgötter standen sie auf den überhängenden, niederdonnernden Kämmen.
Allmählich begriff Steve, worauf es ankam. Immerhin war er jetzt in der Lage, die Richtung zu halten, auch wenn ihm Anapa bereits um einiges enteilt war. Je weiter er sich hinaus wagte, desto höher wurde er gehoben und gesenkt. Gelegentlich schlug ihm eine salzige Gischt ins Gesicht. Er lernte langsam, entsprechend zu atmen und wusste in etwa einzuschätzen, was für eine Welle als nächstes auf ihn zurollte. Als jedoch der nächste kräftige Brecher angerollt kam, fand er sich sehr schnell hilflos paddelnd in den Fluten wieder. Die See hatte ihn auf die Hörner genommen und mitsamt seiner Hartschaumunterlage dorthin zurück befördert, wo er hergekommen war.
Er schaute sich um. Anapa war nur noch als Punkt zu erkennen. Vielleicht sollte er sich einiges bei den Kindern abgucken, die in den flacheren Gewässern tobten. Doch er verzichtete darauf, sich vor ihnen zum Gespött zu machen und wandte sich erneut dem offenen Meer zu. Diesmal kam er zügiger voran als beim ersten Versuch. Das Brett reichte ihm gerade von der Brust bis zu den Oberschenkeln, durch seine Größe war er in der Lage, die Paddelbewegungen mit kräftigen Beinschlägen zu unterstützen.
Das Haupthindernis auf dem Weg nach draußen, die meterhohen Wellen, bezwang er auf diese Weise nicht. Er musste durch sie hindurchtauchen, wenn er nicht ständig zurückgeworfen werden wollte. Das kostete zwar eine Menge Kraft, klappte aber schon ganz gut. Allmählich näherte er sich den großen Brechern. Schon der erste dröhnte und gurgelte in seinen Ohren, als sei das Inferno ausgebrochen. Er versuchte, sich an das Brett zu klammern, das ihm unter dem Bauch wegzurutschen drohte, doch vergeblich. Zwar schaffte er es noch einmal, sich auf den gelben Untersatz zu schwingen, aber jetzt lag er quer zur Brandung. Der Ozean spielte mit ihm Katz und Maus. Als er erschöpft an den Strand kroch, stellte er fest, dass sein Bauch rötlich schimmerte, als hätte man ihn mit Schmirgelpapier bearbeitet.
Er winkte Anapa zu, der sich offenbar um ihn sorgte. Wie machen die das nur? Nach zwei unbeholfenen Anläufen lag er da wie ausgepumpt und die Tahitianer tummelten sich unverdrossen weiter, und zwar dort, wo der Tanz erst richtig begann. Keiner von ihnen kam auf die Idee, an Land zu gehen. Es schien, als sei das Wasser ihr eigentliches Element und ein fester Untergrund nur zum Schlafen da. Eine Coladose dümpelte zu seinen Füßen, wenige Meter weiter wurde ein Autoreifen an den Strand gespült. Steve überlegte, ob er ihn auf einen der Müllhaufen werfen sollte, die sich in größeren Abständen türmten, aber dann schlief er ein.
Jemand stieß ihm in die Seite. Es war Anapa, der sich neben ihm auf den Autoreifen stützte.
„Flaschenpost aus dem Global Village“, bemerkte er grinsend und rollte das Ding zum nächsten Müllhaufen. Es war ein Regenreifen, seine Profilspur wirkte absolut deplatziert. Tahitis schwarze Strände waren allenfalls mit wohlgeformten Abdrücken menschlicher Füße verziert oder mit den bizarren Trippelspuren einheimischer Vögel.
„Du solltest dich eincremen“, mahnte Anapa, nachdem er zurückgekehrt war. Er zwinkerte Fara zu, die mittlerweile ebenfalls dem Meer entstiegen war. Sie zog Steve wie selbstverständlich das T-Shirt über die Schultern. Sein weißer Spargelkörper nahm sich wie ein Witz aus neben ihrer samtbraunen Gestalt.
„Ich wette, du hast meinen Namen vergessen“, neckte sie ihn, während sie ein duftendes Öl auf seiner Haut verrieb.
„Fara. Du heißt Fara“, antwortete er.
Sie lächelte zufrieden. Ihre Finger rutschten überall hin, über seine Stirn, das Gesicht, den Hals, die Ohren, sie griffen sich die Hüften und fuhren in die Kuhle über dem Magen.
„Heute Abend wird der Dreck abgeholt“, hörte Steve Anapas Stimme, während er mit geschlossenen Augen Faras Berührungen genoß. „Jedenfalls die Plastiksachen und der andere Scheiß. Das Zeug wird auf ein Schiff verladen und nach Japan verbracht. Japan ist schließlich einer der Hauptverursacher für die Meeresverschmutzung. Das Treibholz verbrennen wir. Das sind unsere Freudenfeuer. Nimmt allerdings beängstigende Ausmaße an in letzter Zeit. Wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus ... für heute abend hätten wir schon wieder mehr als genug zusammen.“
Steve musste lachen. Angesichts des gigantischen Müllteppichs, der im Südpazifik trieb, war dies eine erstaunlich lockere Betrachtungsweise.
Fara knetete seine ausgestreckten Finger, dann ließ sie von ihm ab.
Steve bedankte sich.
„Wie könnt ihr es nur mit diesen Brechern aufnehmen?“, fragte er und deutete hinaus auf den Ozean.
„Du musst ein Gefühl dafür entwickeln, was dir die Wellen zugestehen“, antwortete Anapa. „Du musst sie spüren, und zwar mit deinem ganzen Körper. Dazu braucht es keinen Mut. Mut ist was für Blöde. Mut heißt ‚Ich will!‘ — so eine Einstellung kann beim Surfen tödlich sein.“
„Es ist ein Gefühl, als würde man Teil einer Kraft werden, die schon lange vor uns war und noch lange nach uns Bestand haben wird“, ergänzte Fara und strich Steve zärtlich durchs Haar.
Den Nachmittag verbrachten sie im Dschungel, im Schatten der Cascade Topatari. Anapa stieg mit den anderen beiden Jungs weiter in die Berge, während Steve und Fara am Wasserfall zurückblieben. Über eine Stunde saßen sie schweigend an dem See, in den sich die herab rauschenden, Wassermassen ergossen. Ein angenehm kühler Wind fächelte ihnen in dem Getöse zu und ihre Gesichter wurden von einem feinen Sprühregen benetzt, der auch die Felsen rundum zum glänzen brachte. Nachdem Steve drei Monate im Cyberspace verbracht hatte, konnte er kaum glauben, wie schön die Welt war. Und wie angenehm es sich in Gegenwart dieses Mädchens sein ließ. Sie war ganz anders, als die Mädchen, die er bisher in England kennen gelernt hatte und deren Eitelkeit und Selbstbezogenheit auf ihn nur peinlich und lächerlich gewirkt hatten.
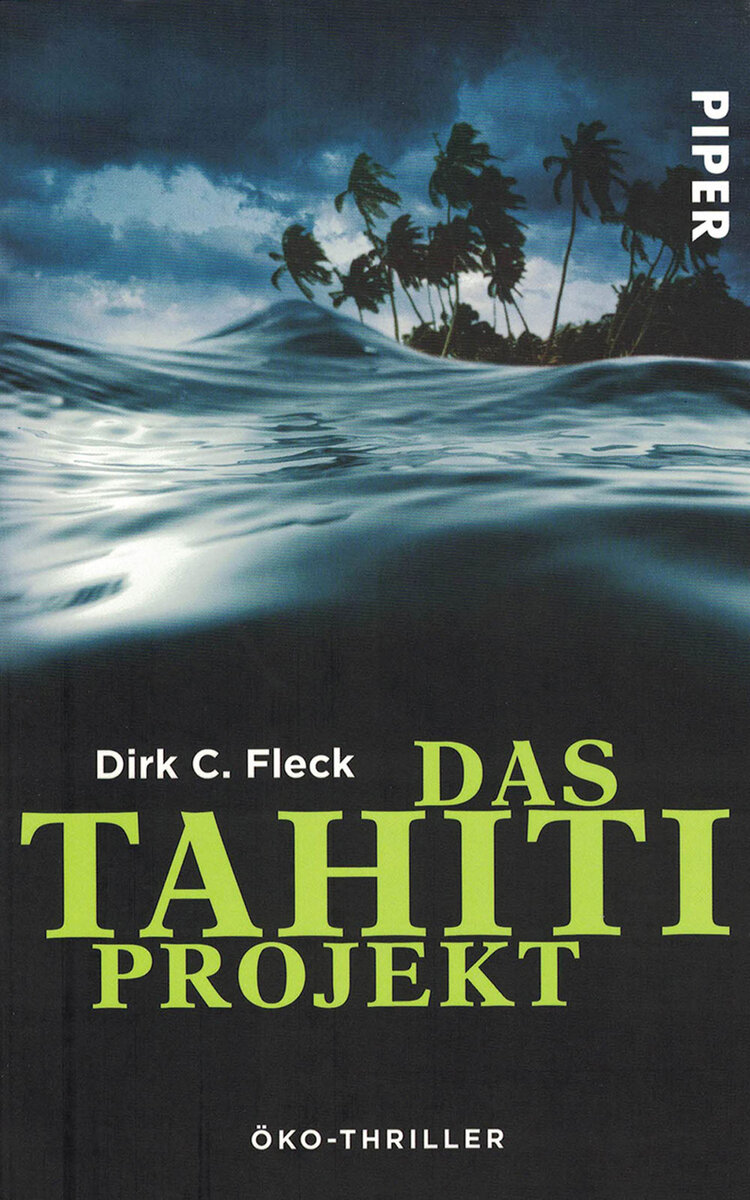
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem Dauerauftrag von 2 Euro oder einer Einzelspende unterstützen.
Oder senden Sie einfach eine SMS mit dem Stichwort Manova5 oder Manova10 an die 81190 und mit Ihrer nächsten Handyrechnung werden Ihnen 5, beziehungsweise 10 Euro in Rechnung gestellt, die abzüglich einer Gebühr von 17 Cent unmittelbar unserer Arbeit zugutekommen.
Quellen und Anmerkungen:
*Die Erklärungen der im Roman verwendeten Fachbegriffe sowie Hinweise für interessierte Leser auf weiterführende Literatur oder Webseiten befinden sich im Buch. Obwohl das „Tahiti-Projekt“ ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten Veränderungen in Richtung auf eine zukunftsfähige Lebensweise begonnen wurde.





