Es verkehrte nur noch eine Fähre von Papeete nach Moorea, und das morgens um sieben. Cording stand schlaftrunken an Deck und beobachtete das Anlegemanöver. Es war ein schwüler Tag, die Wolken hatten die Berge verschluckt und drückten in die Täler, als wollten sie die Insel mit sanfter Gewalt im Meer versenken.
Tahitis Nachbarinsel war von unvergleichbarer Schönheit, als hätte der Schöpfer mit ihr das Paradebeispiel einer Südseeinsel schaffen wollen. Cording erinnerte sich daran, wie sehr Omai damals darauf bestanden hatte, mit ihm nach Moorea zu fahren. Einen besseren Ort, um wieder zu sich zu kommen, gab es nicht. Er bedauerte lediglich, dass er vergessen hatte, Steve Bescheid zu sagen, aber der würde sich schon zu beschäftigen wissen.
Cording ging mit den wenigen anderen Fahrgästen von Bord. An der Servicestation, so hatte man ihm gesagt, gäbe es Fahrzeuge zu mieten. Es waren aber nur dreirädrige Elektro-Kabinenroller im Angebot, so genannte ‘Honu-Tere‘*, was so viel bedeutete wie ‚schnelle Schildkröten‘. Nachdem er einige Einführungsrunden auf dem Parkplatz gedreht hatte, fuhr er auf der Küstenstraße nach Westen. Am Anfang kam er sich albern vor hinter der hohen Windschutzscheibe seines flüsternden, batteriebetriebenen knallgelben Gefährts. Es dauerte jedoch nicht lange, da gewöhnte er sich an die schräge Sitzhaltung, die dem Fahrer automatisch abverlangt wurde. Auf den ersten 15 Kilometern hatte er die Straße für sich. Ein paar Hühner federten mit langen Schritten über die Fahrbahn, die Hunde machten müde Platz, ansonsten kam ihm nichts in die Quere. Die Hotelanlagen neben der Strecke waren vollständig von der wuchernden Natur zurückerobert worden.
Auch den Club Med gab es nicht mehr. Cording stieg aus und schritt durch das aus den Angeln gehobene Portal in ein verwildertes Reich, das vor zwanzig Jahren noch eine bedeutende Zufluchtstätte für wohlhabende Touristen gewesen war. Weil Frankreich nicht überall sein konnte, hatte sich der Franzose Gilbert Trigano 1950 in den Kopf gesetzt, die französische Lebensart in kleine, einheitliche Spaßgehege zu exportieren, die er an die schönsten Strände der Welt baute. Das imposanteste dieser Gehege befand sich auf Moorea. Es hatte bereits vor einigen Jahren schließen müssen, die französische Lebensart war nicht mehr gefragt auf den Gesellschaftsinseln.
Cording kehrt zurück auf die Straße, um eine Unterkunft zu suchen. Das „Hibiskus-Ressort“ befand sich gleich nebenan. Er hatte Glück, einige der vierzig Bambusbungalows waren noch zu mieten. Sein Haus befand sich wenige Meter vom Strand entfernt.
Als Lagunenwächter standen zwei majestätische Kautschukbäume links und rechts der Böschung, ihre Wurzeln hatten sich über die Jahrhunderte vermählt und versperrten nun mit einer imposanten Plastik den Weg. Man musste über das Wurzelwerk steigen, eine kleine Treppe hinunter gehen und schon befand man sich an einem feinen weißen Sandstrand, auf dem sich kleine warme Tümpel gebildet hatten. Darin flitzten Dutzende kleiner Fische herum. An die schief gewachsene Palme am Ufer, die sich begehrlich dem Meer zuneigte und nachmittags einen wohltuenden Schatten spendete, konnte er sich gut erinnern.
Er blickte über die Lagune. Unter dem tiefblauen Himmel schien sich selbst das Licht wie ein Besucher vorzukommen. Cording wusste um die Macht der Südseefarben, sie konnten einen Bewohner der norddeutschen Tiefebene in einen Schockzustand versetzen. Er legte sich unter die Palme. Bevor er die Augen schloss, vergewisserte er sich, dass er keiner Kokosnuss im Weg lag, die sich in den Boden rammen wollte.
Er fiel in einen unruhigen Schlaf, in seinem Kopf wirbelten eine Reihe von Bildern auf, als rührte er auf dem Grund eines schmutzigen Sees. Sie kamen schwarzweiß daher, die sich jährlich wiederholenden Jahrhundertfluten, die aufstrebenden Rauchpilze in den Städten nach einem Granateinschlag, die kilometerlangen Flüchtlingstrecks, die Hamburger Crackmädchen, die prügelnden Polizisten aus Bogota, Bangkok oder Barcelona in ihren aberwitzigen Rüstungen. Selbst die Luftballons, die von der Decke der Kongresszentren schwebten, wenn ein Präsidentschaftskandidat wieder einmal Besserung versprach, waren schwarz-weiß. Indios schauten verwundert aus dem Restdschungel auf die anrückenden Planierraupen.
Cording schreckte hoch. Die Sonne stand bereits im Zenit. Er schüttelte die Albträume von sich und machte sich auf den Weg ins Büro der Hotelbesitzerin. Ihr Name war Eglantine. Eglantine war Französin, sie lebte seit ewigen Zeiten hier und hatte unbeschränktes Aufenthaltsrecht. Trotz ihrer sechsundsiebzig Jahre war sie gesund und voller Energie. Cording hätte sich gerne länger mit ihr unterhalten, wenn da nicht dieser dicke Hund mit seiner nassen, schweren Schnauze gewesen wäre, die er ihm immer wieder in den Schoß rammte. Ein wenig widerwillig kraulte er das sabbernde Tier, schließlich ging es um ein entspanntes Miteinander in den nächsten Tagen.
Kurz darauf machte er sich auf den Weg zu seinem Bungalow. Drinnen war alles sauber hergerichtet, auf dem Kopfkissen lag ein Blütenzweig der Tiaré, dessen süßer Duft den Raum schwängerte. Cording ließ das Moskitonetz herunterrauschen, legte sich in sein durchsichtiges Zelt und griff nach der Fernbedienung, die er aber sofort wieder von sich schleuderte wie einen Fremdkörper. Am Nachmittag noch ein kleiner Strandlauf, danach in den Ozean, anschließend gut essen und es dabei bewenden lassen für heute — wie klang das?
Auf die Strandläufe solltest du besser verzichten, dachte er bei sich, als er verschwitzt und atemlos das Gelände des ’Hibiskus-Ressort’ betrat und auf seinen Bungalow zusteuerte. Er hatte einfach nicht die nötige Kondition. Sich den Fischern als erbärmlich keuchender, dem Erbrechen nahen Freizeitsportler zu präsentieren, wäre auf Dauer zu peinlich gewesen. Also lieh er sich ein Fahrrad und machte sich erneut auf den Weg, die Insel zu erkunden, das war anstrengend genug in der aufkommenden Mittagshitze.
Warum tat er sich das an? Was hatte dieser zwanghafte Drang nach extremer Bewegung und Erschöpfung zu bedeuten? Wollte er sich mit dem Schweiß auch der Schlacken auf seiner Seele entledigen? Am Sofitel gönnte er sich eine Pause. Die einstmals prächtige Hotelanlage war verwaist. Kein livrierter Parkplatzwächter verlangte seine Gästekarte zu sehen, kein gut gewachsener Maori jonglierte zwischen Empfang und Sonnenterrasse im Dienste des Hauses barfuß und halbnackt mit einem Silbertablett voller Früchte zwischen den Gästen hin und her.
Die Liegestühle hatte man auf dem mit Regenwasser bedeckten Grund des Swimmingpools versenkt. Cording stolperte über einen umgekippten, verrosteten Postkartenständer, gab ihm einen Tritt und lief auf dem breiten Holzsteg hinaus in die Lagune. Für die Einheimischen wäre es ein leichtes gewesen, die verlassenen Stelzenhäuser zu besetzen, aber sie entsprachen wohl nicht ihrem Geschmack. Trotz seines erbärmlichen Zustands atmete das gesamte Areal noch immer den Hochmut des Geldes. Cording sah zu, dass er verschwand.
Nach fünf Kilometern erreichte er die Baie d’Oponohu, eine jener beiden Buchten, die wie Finger ins Herz Mooreas stachen. In dieser Bucht war sogar Hollywood am Werk gewesen. Sie diente in den neunziger Jahren als Kulisse für den letzten Aufguss einer Geschichte, die eigentlich auf Tahiti stattgefunden hatte, die „Meuterei auf der Bounty“. Cording legte das Fahrrad ins Gras und steckte die Füße ins seichte Wasser, die nach wenigen Minuten mit dem nassen Element zu verschmelzen schienen.
Er wusste nicht, wie lange er so da gesessen hatte; es mussten Stunden gewesen sein, denn vor ihm erglühten die angehäuften Wolkenmassen des Passats. Eine frische Brise umfächelte sein Gesicht und die Palmenwälder begannen zu Rauschen. Zu Zeiten Robert Luis Stevensons waren hier Palmweinzapfer auf die Bäume geklettert.
„Unmittelbar über einem in dem dichten Blättergewirr erklingt ganz plötzlich das Lied eines unsichtbaren Sängers“, notierte der Schriftsteller in sein Tagebuch. „Weither von einem zweiten Wipfel kommt die Antwort, und noch tiefer im Herzen des Waldes hockt, schwingt und singt ein dritter Musikant. Sie kauern rings auf der ganzen Insel, lassen sich vom Winde schaukeln und spähen nach dem Meere aus, wo sie das Auftauchen der Segel beobachten und ungeheuren Vögeln gleich ihren Morgengesang anstimmen.“
Cording stand auf, er war schon spät dran. Leicht schwankend schob er das Fahrrad den Hügel hinauf. Die Sonne tauchte so schnell ins Meer, als würde man eine Goldmünze fallen lassen. In der einbrechenden Dunkelheit tat er sich schwer mit der Orientierung. Wenn nicht die Mondsichel gewesen wäre, die in ungewohnter Richtung dem glitzernden Ozean zuwanderte, hätte er den Verlauf Straße lediglich erahnen können. Im „Hibiskus“ wartete Eglantine bereits mit dem Essen auf ihn.
Er hörte ihr gerne zu an diesem Abend. Sie erzählte ihm von den ‘Oreros , wie die alten Männer auf Tahiti hießen, die das überlieferte Wissen ihrer Kultur in langen, rhythmischen Texten an die junge Generation weitergaben. Sogar die ursprünglichen Ortsnamen bargen die vollständige Beschreibung ihrer jeweiligen Geschichte.
„Bei Papara gibt es eine Landspitze, deren vollen Namen ich einem der letzten ‘Orero entreißen konnte“, verkündete Eglantine stolz. „Die Landspitze heißt sinngemäß übersetzt: ‚Die Erde von Poreho wo König Teriirere seine Empfänge abhielt und der Wind Fa’aruafa’a vom Berg herab weht und wie ein Fächer auf den Tempel von To’oarai stößt auf den feiner Regen fällt und über den sich der Regenbogen wölbt.‘“
Seine Gastgeberin lachte. „Das ist ein Ortsname, mehr nicht!“, sagte sie und wiederholte das Ganze im Original. „Die maorische Sprache blüht erst auf, wenn man sie spricht. Sie braucht den Menschen, seine Gestik, seine Mimik. Wissen Sie, was die Leute hier sagen? Buchstaben sind wie der Aal am Grunde eines Sees. Gehen Sie morgen früh mit mir die Fische füttern, Monsieur?“
Cording nickte, streichelte dem sabbernden Hund über den Kopf und verschwand in seinem Bungalow. In der Südsee ist es ratsam, sich an die Sonne zu halten. Man schläft mit ihr ein und steht mit ihr auf. Auch das hatte ihm Eglantine verraten. Den Griff nach der Fernbedienung bekam er noch immer nicht unter Kontrolle. Er drehte den Fernseher um. Das würde helfen, den albernen Reflex zu beherrschen.
„Ob es dir passt oder nicht, Omai, ich spiel da nicht länger mit!“
Maeva lief im Amtszimmer ihres Bruders unruhig auf und ab.
„Seit einer Woche warte ich auf ein Zeichen von ihm, niemand weiß, wo er sich befindet. Steve Parker hat seit Tagen nichts von ihm gehört, die Rezeption weiß auch nichts. Sein G-Com hat er in seinem Hotelzimmer liegen lassen. Weißt du was? Such eine andere Begleiterin für ihn aus, ich stehe nicht mehr zur Verfügung ...“
„Was genau hat er dir denn gesagt?“, fragte Omai beschwichtigend. „Er muss doch irgendetwas von seinen Plänen erwähnt haben.“
„Dass er noch nicht angekommen ist, dass er noch drei Tage braucht. Drei Waschtage ... Weißt du vielleicht, was er damit gemeint hat?“
„Allerdings“, antwortete Omai und begann zu schmunzeln. Maeva schaute ihn mit großen Augen an.
„Du weißt, was das bedeuten soll? Was denn? Sag schon!“, drängte sie.
„Er scheint in einer schlechten Verfassung zu sein. Unter Waschtagen versteht er die Zeit, in der er sich einer Art innerer Reinigung unterzieht.“
„Reinigung wovon?“
„Von dem Dreck da draußen, Maeva. Er ist Reporter. Sein Job ist es, genau hinzusehen. Bei sensiblen Naturen bleibt da eine Menge haften. Das kannst du nicht verstehen, du warst ja noch nie außerhalb Polynesiens.“
Maeva stand am Fenster und blickte über die prächtigen Alleebäume hinweg ins Leere. In diesem Augenblick wurde offensichtlich, dass es ihr nicht so sehr um die verletzte Ehre ging, sie war im Herzen getroffen! Omai ging zu ihr und schloss seine Schwester zärtlich in die Arme.
„Der Mann ist in Ordnung“, flüsterte er.
Maevas Wange glühte auf.
„Er hat uns unschätzbare Dienste erwiesen“, fuhr Omai fort. „Er war es, der über die Hintergründe der geplanten Verkäufe von Raiatea und Bora Bora berichtet hatte. Er war es, der mit seiner viel beachteten Reportage über das Desaster im Hafen von Papeete das weltweite Medieninteresse an unserer Widerstandsbewegung geweckt hat. Cording ist unser Freund. Hast du eigentlich nie daran gedacht, dass ihm etwas passiert sein könnte?“
Maeva wand sich aus der Umarmung.
„Ich kann mir vorstellen, wo er sich versteckt hält“, sagte Omai, „ich hole ihn dir zurück.“
„Du holst ihn mir zurück? Was soll das heißen?“ presste sie mit zusammen gekniffenen Augen hervor. Sie sprang auf und rang nach Worten. Sie war plötzlich wieder das kleine Mädchen, das den Mund wie ein Fisch bewegte, wenn die Worte wieder einmal zu klein waren, um ihrer großen Empörung Ausdruck zu verleihen. Damals war sie regelmäßig ohnmächtig geworden, das hatte sich geändert.
„Bemühen Sie sich nicht, Herr Präsident“, stammelte Maeva, „nicht meinetwegen. Ich bin raus, das sagte ich ja schon.“ Sie schloss die Tür hinter sich. Leise. Auch das hatte sich geändert.
Cording döste auf einem verankerten Ponton, der früher den Wasserskiläufern des Club Med als Startrampe gedient hatte. Zum Schutz gegen die Sonne hatte er sich vom Gesicht bis zu den Knien mit einem feuchten Tuch bedeckt. Das Tuch war mit einem Gauguinmotiv bedruckt, ein Geschenk von Eglantine. Aus der Vogelperspektive betrachtet hätte man meinen können, dass die beiden Tahitianerinnen auf seinem Bauch von ihrem Stamm abkommandiert worden waren, um eine wertvolle Beute zu bewachen.
Er wunderte sich über den plötzlichen Wellengang, der den hölzernen Untersatz ins Schwanken brachte. Ehe er sich versah, rutschte er seitlich ins Meer. Etwas zerrte an seinem Bein und riss ihn in die Tiefe. Er geriet in Panik, schlug aus, wand sich, schluckte Wasser. In seinen Ohren war ein Rauschen, als würde sich die ganze Welt über ihn ergießen. Sein Kopf schnellte an die Oberfläche wie ein Ballon, den man unter Wasser gedrückt und plötzlich frei gelassen hatte. Prustend und hustend klammerte er sich an den Ponton. Schließlich gelang es ihm, seinen bleischweren Körper auf die Plattform zu wuchten. Gauguins Tahitianerinnen dümpelten lächelnd auf den smaragdgrünen Wellen.
Während er überlegte, wie er unversehrt an Land gelangen konnte, vernahm er hinter sich ein herzhaftes Lachen. Er drehte sich um und blickte in Omais perlendes Antlitz. Omai wollte sich vor Vergnügen fast ausschütten über den gelungenen Streich.
„Wie geht es meinem deutschen Freund?“, fragte er belustigt.
„Es tut gut, dich zu sehen“, murmelte Cording, „wirklich gut.“
Er war zutiefst gerührt über den unerwarteten Besuch. Omai tauchte wieder ab.
„Komm!“ rief er, als er zwanzig Meter entfernt an die Oberfläche kam.
Cording schwamm ihm hinterher. Gauguins Tahitianerinnen wurden in Richtung des Riffs davongetragen.
Es war ein schmackhaftes Mahl, das Eglantine für sie bereitet hatte. Omai kannte die Französin gut, sie hatte früher eine Ferienpension auf Tahiti Iti betrieben. Die Anlage lag etwas versteckt oberhalb der Straße nach Teahupoo und hatte den Wortführern der Rebellen damals als Unterschlupf gedient.
Zur Feier des Tages hatte sich Tahitis Präsident Mahi-Mahi in Pfeffersauce gewünscht, einen Fisch, dessen Kopf so platt war, als wäre er aus Versehen gegen eine Ufermauer geschwommen. Rudolf, Omais Leibwächter, war auch dabei, ein Maori-Hüne von der Nachbarinsel Huahine. Sie nannten ihn Rudolf, weil er vor fünfzehn Jahren für einige Monate in Baden-Württemberg gewesen war. Rudolf war tief beeindruckt gewesen von den vielfältigen ökologischen Ansätzen, die er in Deutschland vorgefunden hatte. Omai bezeichnete ihn als den eigentlichen Motor des Tahiti-Projekts. Sein Leibwächter hatte nämlich schon die Vorgängerregierung mit Politikschelte und Alternativvorschlägen genervt. Das hörte auch nicht auf, als Omai die Amtsgeschäfte übernahm..
Nach dem Essen starteten die Männer zu einem Ausflug über die Insel. Rudolf saß etwas beengt hinter dem Steuer des solarbetriebenen Kleinwagens der Marke „Matai“*. An der Stelle, an der Cording einige Tage zuvor einen ganzen Nachmittag lang mit den Füßen im Wasser vor sich hin geträumt hatte, bogen sie von der Küstenstraße ab in die Berge. Die schmale Straße führte an üppigen Obstgärten vorbei in einen dichten Wald und schließlich hinauf auf den Belvédère, von wo sich ihnen ein weiter Blick nach Süden auf die beiden Buchten Baie d´Opunohu und Baie de Cook bot. Abgesehen von einigen Hühnern hatten sie die Aussichtsplattform, die früher durchgehend von Touristen belagert worden war, ganz für sich.
Omai deutete auf einen steil aufragenden Berg, in dessen kahlem Gipfel sich ein kreisrundes Loch befand, durch das ein gebündelter Lichtstrahl drang.
„Das ist der Mouaputa, der durchlöcherte Berg, wie wir ihn nennen“, sagte er. „Es heißt, dass Hiro, der Gott der Diebe, heimlich nach Moorea kam, um den Berg Rotui zu stehlen. Doch der tahitianische Halbgott Pai erfuhr von dem Plan, schleuderte eine riesige Lanze übers Meer und schlug Hiro in die Flucht. Die Lanze durchbohrte den Mouaputa, das Loch ist heute noch deutlich zu sehen. Es heißt, dass jeder, der den Mouaputa bei Tag- und Nachtgleiche besteigt, vom Atem der Götter vernichtet wird.“
„Nur gut, dass es mir an der nötigen Kondition mangelt“, erwiderte Cording lächelnd. „Kompliment übrigens für deine kleine Ansprache vor den Journalisten. Sokrates auf Tahiti, nicht schlecht.“
„Eigentlich wollte ich Novalis zitieren“, erwiderte Omai verschmitzt, „aber den kennt ja keiner von euch Journalistenbanausen ... ‚Wer dieses Stammes und dieses Glaubens ist, wird nimmer müde, die Natur zu betrachten und mit ihr umzugehen. Nicht weise scheint es, eine Menschenwelt ohne volle aufgeblühte Menschheit akzeptieren zu wollen‘.“
„Die Lehrlinge zu Sais ...“, sagte Cording. „Du überrascht mich. Woher kennst du den Freiherrn von Hardenberg?“
„Den hast du mir doch geschenkt, erinnerst du dich nicht?“
„Ich hab ihn dir empfohlen ...“
„Geschenkt — das sag ich doch.“
„Welche Bedeutung hatte das weiße Gewand?“ wollte Cording wissen, „und warum der Schemel?“
„Ich bin ein direkter Nachfahre jenes Mannes, der euch Europäern den Südsee-Mythos eingeimpft hat“, antwortete Omai. „1774, nach seiner zweiten Pazifikreise, präsentierte Kapitän James Cook der Londoner Society den ersten ´edlen Wilden´ aus Tahiti. Der Mann hieß Omai, stammte von der Insel Huahine und war nur deshalb nach Tahiti geflohen, weil sein Vater Besitz und Leben in einem Krieg verloren hatte.“ Sie schlenderten die schmale, von Schlaglöchern übersäte Straße hinunter, auf der sie gekommen waren.
„Gleich nach der Ankunft wurde Omai König Georg III. vorgestellt. ‚Sein natürlicher Anstand ließ ihn das Zeremoniell am Hofe nach kurzer Belehrung mit Bravour bewältigen‘, schrieb eine Dame des Hochadels in ihr Tagebuch. Omai blieb keine Tür zu Londons höchsten Kreisen verschlossen. Er entwickelte sich zum Opernliebhaber, ging auf Fuchsjagden und lief im Winter Schlittschuh. Zu offiziellen Empfängen erschien er in einem langen weißen Gewand mit einem Schemel unterm Arm. Er setzte sich ausschließlich auf diesen Schemel. Es ist derselbe, den ich dabei hatte.“
Ein Bauer kreuzte ihren Weg. Der Mann verbeugte sich vor Omai und stieß mit ihm an, Faust gegen Faust. Cording wunderte sich, dass zwischen den beiden nicht ein einziges Wort gewechselt wurde.
„Schließlich war es die Lady mit dem Tagebuch, die sich meines bedauernswerten Vorfahrens erbarmte“, fuhr Omai fort. „‚Ich bekam das Gefühl, ihm würde die Eitelkeit zu Kopf steigen‘, schrieb sie, ‚ich nahm ihn zur Seite und verabreichte ihm als Heilmittel die Wahrheit: Unser Umgang mit ihm sei so vertraut, weil uns seine Seltenheit belustige. Als Eingeborener stehe er außerhalb aller Etikette, was den Umgang mit ihm gefahrlos mache. Wäre er unter uns geboren, so würden wir ihn kaum ansehen, denn ihm fehle jeder Rang. So aber fühlten wir mit ihm eine paradiesische Freiheit, die wir uns selbst niemals gewährt hätten.‘“
Inzwischen waren sie bei dem Marae Titiroa angekommen, den Cording schon auf der Hinfahrt bemerkt hatte. Die Kultstätte befand sich in einem schlechten Zustand. Ihre dicken Mauern waren von Baumwurzeln angehoben worden, das heilige Quadrat war übersät mit schwarzen, heraus gebröckelten Steinen. Eine Familie mit zwei Kindern hockte auf dem Boden, der Vater spaltete eine Kokosnuss und die Mutter schnitt Papayas. Als sie Omai erkannten, standen sie auf und machten eine Verbeugung. Die Kinder blieben sitzen und wunderten sich. Nachdem ihnen die Eltern etwas ins Ohr geflüstert hatten, kamen sie herbei gerannt.
„Ari’i rahi nui! — (Großer Häuptling!)“, riefen sie, „Ari’i rahi nui!“
Sie streckten dem Präsidenten ihre kleinen Fäuste entgegen und stoben lachend davon, nachdem dieser den rituellen Gruß erwidert hatte.
Draußen fuhr Rudolf auf dem Parkplatz vor. Omai setzte sich auf die Mauer, was Cording ein wenig despektierlich fand. Dort wo der Leibwächter parkte, hatte früher ein großes Warnschild gestanden mit der Aufschrift: „Opaietaeta roa Hiara Pamma unia ite Marae -- Das Betreten des Marae ist verboten“. Diese Schilder brauchten sie nicht mehr auf den Inseln, sie waren jetzt unter sich. Nach kurzem Zögern schwang sich auch Cording auf die Mauer.
„Ich möchte, dass du uns nach Tahiti begleitest“, sagte Omai unvermittelt, „wir brauchen dich.“
„Ich komme gerne mit“, antwortete Cording, „allerdings wüsste ich nicht, wie ich euch von Nutzen sein könnte. Sie werden meine Reportage nicht drucken. Sie verlangen einen Bericht aus dem Innenleben einer durchgeknallten Politsekte.“
„Du wirst uns helfen“, bemerkte Omai lächelnd. Er lächelte noch, als Rudolf ihm die Autotür aufhielt.
Niemand im Hotel hatte ihm sagen können, wo er Steve fand. Dabei hätte Cording ihm gerne den Präsidenten vorgestellt, mit dem er im Regierungspalast verabredet war. Im Vorzimmer traf er Rudolf, der sich gerade einen Spot ansah, der im Rahmen der ökologischen Aufklärungskampagne demnächst im Fernsehen ausgestrahlt werden würde. Er begleitete den Deutschen in Omais Amtszimmer, wo ihn dieser bereits erwartete.
„Setz dich“, sagte Omai.
Cording betrachtete das Bild hinter dem Schreibtisch, auf dem ein Mann in graziler Pose vor einem Palmenhain zu sehen war. Er trug ein weißes Gewand und einen Schemel unter dem Arm. Darunter stand auf Englisch: „Nie wieder sah ich eine anmutigere Erscheinung. Man hätte denken können, er entstamme einem ausländischen Königshof.“ Cording bewunderte die kunstvolle Radierung, die kein Detail unbeachtet ließ.
„Ich werde die nächsten Tage nicht auf Tahiti sein“, hörte er Omai sagen, „ich muss auf die Fidschis reisen. Deine Begleiterin Maeva hat übrigens den Dienst quittiert, sie steht nicht mehr zur Verfügung. Aber keine Sorge, für Ersatz ist gesorgt. Ihr Name ist Uupa.“
„Hat Maeva meinetwegen den Dienst quittiert?“ fragte Cording.
„Erraten. Deinetwegen, ja ...“
„Und Uupa? Ist sie auch so schön wie Maeva?“
„Wie schön findest du Maeva denn?“
„Sie hat den sinnlichsten Mund, den ich je gesehen habe“, antwortete Cording. „Sind dir ihre fein geschwungenen Augenbrauen aufgefallen, von denen sich die linke erhebt wie ein Vogel, während die rechte in einer sanften Kurve bis in alle Ewigkeit zu verharren scheint ...? Vielleicht ist es gut so. Ich befinde mich nämlich in einer Verfassung, in der man sich einem solchen Wesen gegenüber immer schuldig fühlt ...“
„Eigentlich sind die polynesischen Frauen sehr einfach zu verstehen“, erwiderte Omai, „wir müssen nur anerkennen, dass sie es sind, die die wahre Seele des Mannes ausmachen.“ Nach einer Pause fügte er hinzu: „Du hast sie gedemütigt, mein Freund. Ich mache dir keinen Vorwurf, aber du hast sie gedemütigt, das sollst du wissen.“
Sie verabredeten sich für den nächsten Mittwoch, dann würde Omai von den Fidschi-Inseln zurück sein. Rudolf fuhr ihn zurück ins Hotel. Alles Leben findet im Herzen statt, dachte Cording, als er sich aufs Bett warf. Alles Erleben ist Illusion. Gleich morgen würde er Kontakt mit Uupa aufnehmen, das war er Omai schuldig nach der Schmach, die er Maeva angetan hatte.
Professor Thorwald Rasmussen saß in dicke Wolldecken gehüllt auf der Terrasse seines ehemaligen Studienfreundes, des Earl of Mansfield. Er blickte auf die weiße Zeltstadt unten im Tal, die in den letzten Tagen eigens für das Highland Game errichtet worden war. Das jährliche Spektakel vor Scone Palace unweit der Stadt Perth sollte ihn auf andere Gedanken bringen — so jedenfalls die Hoffnung seines bemühten Gastgebers. Aber weder dem Earl noch seiner Gattin wollte es gelingen, den schweigsamen Dänen aus seiner Lethargie zu reißen. Sie trauten sich nicht einmal, das Wort an ihn zu richten, so still und konzentriert meditierte der Wissenschaftler über sein Schicksal, das seinen Körper energetisch auszulaugen schien, während gleichzeitig eine grimmige Entschlossenheit in ihm heranwuchs.
Rasmussen spürte sehr wohl, dass der Earl nur zu gerne mit ihm den Berg hinunter gestiegen wäre, um sich unter die dreißigtausend Menschen zu mischen, die in ihrer traditionellen Kleidung das alte Schottland zelebrierten. Die Idee, sich in der Menge auf den schulterlangen Hirtenstab des Earl zu stützen und pralles Leben zu atmen, den Dudelsäcken zu lauschen und den Geruch von gegerbtem Leder, Gras, Schafspelzen, Bonbons und geölten Waffen zu inhalieren, gefiel Rasmussen. Aber er fand nicht die Kraft zu derlei Ablenkung. Er war in Gedanken bei seiner Familie. Er würde keine Ruhe finden, bevor es ihm nicht gelungen war, den ganzen Mordapparat auffliegen zu lassen. Morgen würde er den Zug über Edinburgh nach London nehmen. Es war Zeit zu handeln. EMERGENCY war nicht die schlechteste Adresse, um seinen Rachefeldzug zu beginnen.
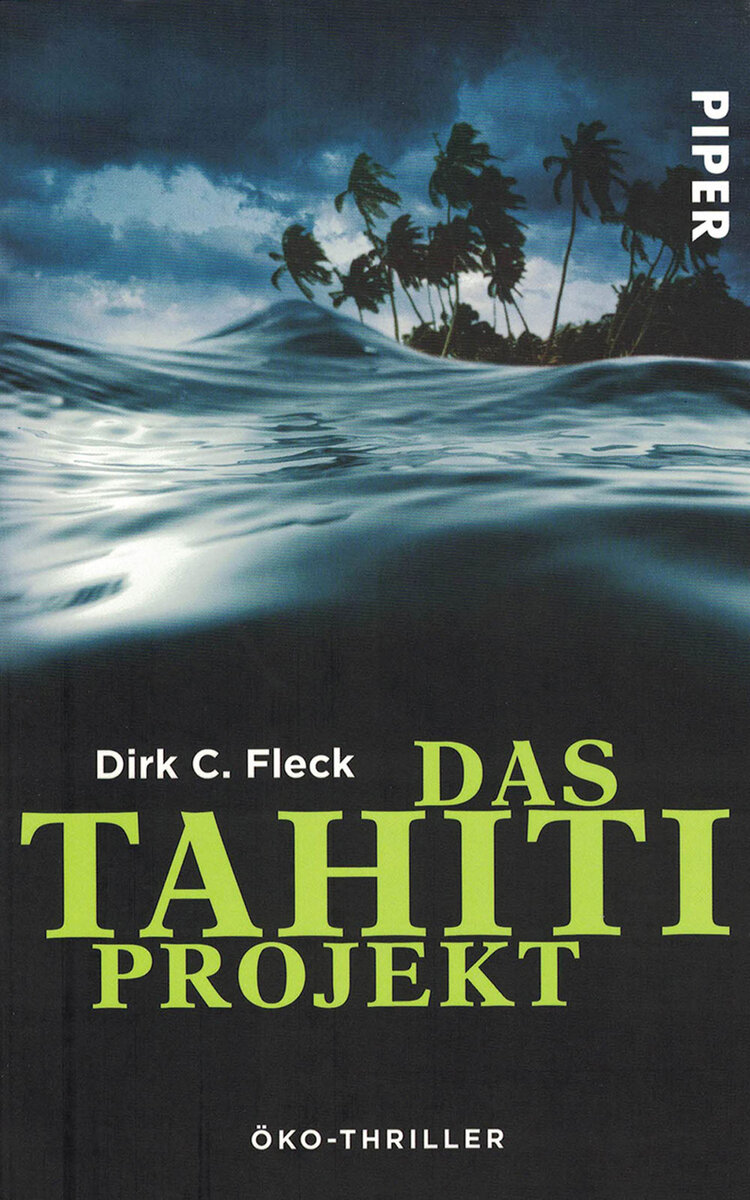
Hier können Sie das Buch bestellen: equilibrismus.org

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem Dauerauftrag von 2 Euro oder einer Einzelspende unterstützen.
Oder senden Sie einfach eine SMS mit dem Stichwort Manova5 oder Manova10 an die 81190 und mit Ihrer nächsten Handyrechnung werden Ihnen 5, beziehungsweise 10 Euro in Rechnung gestellt, die abzüglich einer Gebühr von 17 Cent unmittelbar unserer Arbeit zugutekommen.
Quellen und Anmerkungen:
(1) Wörtlich: „redegewandt“, Vortragskünstler.
*Die Erklärungen der im Roman verwendeten Fachbegriffe sowie Hinweise für interessierte Leser auf weiterführende Literatur oder Webseiten befinden sich im Buch. Obwohl das „Tahiti-Projekt“ ein Zukunftsroman ist, sind die in ihm dargestellten technischen Lösungen und sozioökologischen Modelle keine Fiktion: sie existieren bereits heute! Das einzig Fiktive ist die Annahme, dass irgendwo auf diesem Planeten tatsächlich mit konkreten Veränderungen in Richtung auf eine zukunftsfähige Lebensweise begonnen wurde.





