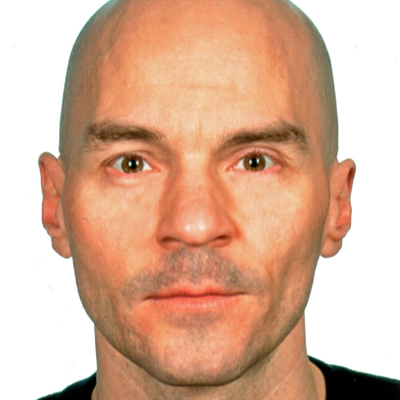„All die Dinge, die Sie wahrscheinlich am Reisen hassen, die klimatisierte Luft, das künstliche Licht, die Saftautomaten, das billige Sushi, geben mir das wohlige Gefühl, zuhause zu sein. Mich zu kennen heißt, mit mir zu fliegen. Hier lebe ich.“ Ryan Bingham (George Clooney) ist Globalisierungsgewinner par excellence und liebt sein Leben im Luxus. Er fliegt beruflich kreuz und quer durch Amerika und gönnt sich keine Auszeit. Für die Beratungsfirma CTC führt er Kündigungsgespräche mit Mitarbeitern im Auftrag der Firmen, die sich in der grassierenden Wirtschaftskrise gezwungen sehen, Personal „freizusetzen“.
Doch sein rastloses Leben in der „Gesellschaft der Singularitäten“ (1) zwischen Airport, Hotelbar und Büroturm gerät plötzlich aus der luxurierten Routine, als er Alex (Vera Farmiga) kennenlernt – eine seelenverwandte Frau, die ganz ähnlich zu leben und zu denken scheint wie er selbst: „Ich bin die Frau, um die Du Dir keine Gedanken machen musst. Betrachte mich so, als wäre ich Du – nur mit Vagina.“ Als seine Schwester ihn zu ihrer Hochzeitsfeier einlädt und überdies seine neue, frisch examinierte Kollegin Natalie Keener (Anna Kendrick) seinen unbekümmerten Lebensstil radikal in Frage stellt, regen sich bei Bingham allmählich Zweifel, ob er sich tatsächlich noch auf dem richtigen Weg befindet. Als er Alex ernsthaftere Absichten signalisiert, muss er jedoch entdecken, dass sie nicht die Frau ist, für die sie sich ausgibt ...
Bewegung oder Tod
Mit „Up In The Air“ (2009), seinem dritten Film, gelang Regisseur Jason Reitman ein seltenes Kunststück: Die Inszenierung eines schwerblütigen Stoffs als vielschichtig schwebende Tragikomödie im ersten Jahr nach Ausbruch der schwersten Weltwirtschaftskrise seit 1929, deren Nachwirkungen bis heute makroökonomisch durch nichts überwunden sind (2).
Bereits das Design der Titelsequenz ist ein kleines Meisterstück des „setting the mood“ – ein zweiminütiges, zeitloses Tongedicht. Das Leben im Transitraum, die Liebe im Hotel, der Luxus auf Reisen – galant, ideenreich, perfekt in Tempo und Timing, eröffnet die Story frei von Genrekonventionen einen Raum ausgefeilter Dramaturgie. Der automatisiert freundliche Touch, der die Welt des Protagonisten in ihrer Luxusumlaufbahn gehobener Mittelschicht hält, täuscht zunächst über tiefe Risse hinweg, die sich jedoch schon bald unter der glattpolierten Oberfläche seines Einzimmerapartments auftun.
Binghams Professionalität ist coole Fassade, hinter der eine tiefe Einsamkeit steckt, die von ihren eigenen Abgründen allgegenwärtig lauernder Abstiegsangst (3) nichts wissen will. Grandios gespiegelt in Sounddesign und Bildmontage, wenn der Business-Mann akribisch seinen Trolley-Koffer packt, scheint es für ihn nur ein Ziel zu geben: zehn Millionen Bonusmeilen. Die Meilen haben kein Ziel, sie sind das Ziel – Bewegung bedeutet Leben, Stillstand beinahe Tod: „Je langsamer wir uns bewegen“, so doziert Bingham bei einem seiner Motivations-Vorträge, „umso schneller sind wir tot. Wir sind Haie.“
Der Exportmythos
In einer Szene, die leider nicht Eingang in die finale Schnittfassung fand, bekennt die Hauptfigur: „Ich bin wohl eine Mutation, eine neue Spezies. Ich lebe zwischen den Rändern meiner Reiserouten.“ Und in der Tat – lässt man sich von massenmedialen Einflüsterungen über „Globalisierung“ nicht irritieren, wird deutlich, dass der Film einen Lebensstil in Szene setzt, den man zu den seltenen Luxusphänomenen der Verwöhnung einer (noch) aufstrebenden Mittelklasse rechnen muss. Der Historiker Jürgen Osterhammel bemerkt lakonisch: „Selbst heute, im Zeitalter von Satellitenkommunikation und Internet, leben Milliarden in engen, lokalen Verhältnissen, denen sie weder real noch mental entkommen können. Nur privilegierte Minderheiten denken und agieren 'global'“ (4).
Ähnlich – und empirisch fundiert – argumentiert Pankaj Ghemawat, seit 2006 Professor für Ökonomie und Globale Strategie an der IESE Business School in Barcelona. Seine These: Die Welt ist weniger globalisiert, als wir gemeinhin glauben. Seine Datenbeispiele, um dies zu belegen: Nur drei Prozent der Menschen leben derzeit außerhalb des Landes, in dem sie geboren wurden; nur zwei Prozent der Telefongespräche sind grenzüberschreitend; nur etwa zwanzig Prozent des Internetverkehrs überschreitet nationale Grenzen; ausländische Direktinvestitionen machen nur etwa 9 Prozent aller Anlageinvestitionen aus – und: Die Quote der ausländischen Direktinvestitionen relativ zum BIP ist erst seit kurzem höher als vor 1914! Sein ernüchterndes Fazit: Wie auch immer man die Statistiken dreht und wendet, der Großteil allen Verkehrs von Menschen, Informationen, Gütern und Kapital findet weiterhin national, nicht international statt. Bestenfalls könne man demnach von einer „Semiglobalisierung“ und einem Globalisierungsgrad von maximal zwanzig Prozent sprechen.
Und man darf ergänzen: „Globalisierung“ erfüllt – besonders in Export-Deutschland – für die Unternehmerverbände nicht selten die Funktion der wirtschaftspolitischen Drohkulisse und rhetorischen Kampfkeule zur maximalen Disziplinierung der „Ware“ Arbeitskraft. Herbert Schui hat diesen Exportmythos erfrischend klar entlarvt: „Der konkrete Zweck ist, im Rahmen der Wettbewerbsideologie der deutschen Exportindustrie (mehr als die Hälfte der deutschen Produktion wird exportiert) bei niedrigen Löhnen zu einem hohen Umsatz zu verhelfen – ideologisch gleitfähig gemacht mit dem Hinweis, dass das Arbeitsplätze schaffe. Die Parole heißt, sich dem Sachzwang zu beugen, den die Mächte Markt und Wettbewerb ausüben“ (5).
Elendsökonomie
Exportoffensiven verschießen zwar keine Patronen, sind aber dennoch nichts anderes als brutale Handelskriege – der Kabarettist Georg Schramm nannte dies einst „Menschenopfer für Wachstum“. Bezahlt wird dieser Exportwahn mit einer grassierenden, ja transversalen Prekarisierung (6) aller erdenklichen Berufsmilieus und Lebensverhältnisse – und möglich wird dieser ökonomische Irrsinn erst durch eine zerstörerische Umverteilung innerhalb der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung von den Arbeits- zu den Besitzeinkünften (also von Löhnen zu Zinsen, Mieten/Pachten und Gewinnen).
Der daraus kausal abzuleitende, erschütternde Befund: Solange sich im (a)sozial tief gespaltenen Unternehmer- und Suppenküchenstaat Deutschland nicht einmal auch nur ein lächerlicher Prozentpunkt Vermögenssteuer politisch durchsetzen lässt, wird die ruinöse Drift in die Elendsökonomie weitergehen. Klar ist auch: Brechen künftig die deutschen Exporte ein (und das werden sie unweigerlich, da sich die europäischen Nachbarn diesen deutschen Austeritätswahn nicht mehr lange aufzwingen lassen), wird dies zu schweren endogenen Desintegrationen führen – ein Ausdruck, den Jürgen Osterhammel als präzises Synonym für den Bürgerkrieg eingeführt hat (7).
Augenblicke ohne Spitze
Doch zurück zu „Up In The Air“: Es macht den besonderen Charme des Films aus, dass sich in ihm die Nähe zu Martin Heideggers Phänomenologie der Langeweile erkennen lässt, die der Meisterdenker aus Meßkirch einst in den „Grundbegriffen der Metaphysik“ seiner Vorlesung des Wintersemesters 1929/30 enwickelte (8). Peter Sloterdijk hat dies schwungvoll in Erinnerung gerufen: „Vor dem Unbehagen in der Erleichterung gibt es kein Entrinnen: Weil im abgerüsteten Dasein das innere Ernstfall-Urteil ausbleibt, fühlt sich das Subjekt einer schalen Entlastung ausgesetzt. Seine Leichtigkeit tut ihm auf merkwürdige Weise weh – oder besser, es fühlt sich von dem, was weh tun könnte, beunruhigend abgeschnitten. Es ist sich selber gleichgültig – und das zu Recht, da es ihm so, wie es gegenwärtig lebt, bei allem, was es unternimmt, um nichts Wirkliches gehen kann. Das unergriffene Leben langweilt sich. Langeweile, das heißt: man erfährt die eigene Zeit als eine innere Dehnung, die übermäßig auffällt, weil sie sich nicht in sinnvollen Handlungen erfüllt. Sie wird erlebt als quälende Dauer vor dem Eintritt des nächsten Ereignisses, das die Stauung auflöste. Paradigmatisch: stundenlanges Warten auf den Zug an einem Provinzbahnhof“ (9).
Daher die sinnlose Jagd nach Bonusmeilen und Statussymbolen. Heidegger selbst hatte von der Langeweile als das „Entschwinden der Spitze eines Augenblicks“ gesprochen – gegenwärtig zeichnet übrigens das soziologische Konzept des Resonanzverlusts (10) durchaus starke Verbindungslinien zu Heideggers expressionistischer Phänomenologie der Langeweile. Zudem erkennt man hinter dem Leerlauf der Statussymboljagd leicht jene tiefen Risse in der Leistungsideologie des Neoliberalismus: Diese Ideologie erweist sich als eine „Ordnung, die einem schwarzen Loch ähnelt. In seinem Zentrum ist nichts als Leere und alles, was in dessen Anziehungskraft gerät, wird von jedweder konkreten oder individuellen Bedeutung entleert. Die Bedeutungen der heutigen Waren und Menschen sind letztlich nichts als zur Verwertung unerlässliche Simulakren. Ökonomisierung ist aus dieser Sicht eine gesellschaftliche Bewegung, die Schritt für Schritt jedes Bedeutungsverhältnis unterminiert, indem sie alles in eine Tautologie verwandelt – und genau darin liegt das eigentliche Problem der Ökonomisierung“ (11).
Wer hätte je gedacht, dass sich Heideggers schwerblütige Gedankenwelt und die reine Verwertungstautologie von Kapital und Arbeit derart leichtfüßig in zeitgenössische Bilder auf höchst unterhaltsame Weise übersetzen ließe? Im inneren Monolog versunken, steht Ryan Bingham zuletzt mit suchendem Blick vor der Fluganzeigetafel. Die Angst, sterblich zu sein, evoziert eine diffuse Sehnsucht nach Bedeutung und Jagd nach Intensität (12). Gibt es einen Ausweg aus dem Dilemma seiner prekären Luxuslüge zwischen Leichtsinn und Langeweile, Statuspanik und Simulakrum? „Heute Abend werden die meisten Menschen zuhause von hochspringenden Hunden und quietschenden Kindern begrüßt. Ihre Partner werden fragen, wie ihr Tag war, und die Nacht werden sie in ihrem Bett verbringen. Die Sterne werden aus ihrem Versteck emporsteigen. Und eines dieser Lichter, ein wenig heller als die anderen, wird die Spitze meines Flügels sein, wenn ich vorüberfliege.“ Im Abspann schneidet eine Linienmaschine durch die Wolken.
Anmerkungen und Quellen:
(1) Reckwitz, Andreas: Die Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne. Berlin: Suhrkamp 2017.
(2) Siehe aktuell nur: Bischoff, Joachim/Steinitz, Klaus: Götterdämmerung des Kapitalismus? Eine Flugschrift. Hamburg: VSA 2016; Bontrup, Heinz-J.: Krisenkapitalismus und EU-Verfall. Köln: PapyRossa 2016; Hudson, Michael: Der Sektor. Warum die globale Finanzwirtschaft uns zerstört. Stuttgart: Klett-Cotta 2016; Hudson, Michael: Finanzimperialismus. Die USA und ihre Strategie des globalen Kapitalismus. Stuttgart: Klett-Cotta 2017; Marazzi, Christian. Verbranntes Geld. Zürich: diaphanes 2011; Massarrat, Mohssen: Braucht die Welt den Finanzsektor? Postkapitalistische Perspektiven. Hamburg: VSA 2017; Sayer, Andrew: Warum wir uns die Reichen nicht leisten können. München: C.H.Beck 2017.
(3) Hierzu empirisch fundiert: Atkinson, Anthony B.: Ungleichheit. Was wir dagegen tun können. Stuttgart: Klett-Cotta 2016; Nachtwey, Oliver: Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne. Berlin: Suhrkamp 2016; Wehler, Hans-Ulrich: Die neue Umverteilung. Soziale Ungleichheit in Deutschland. München: C.H.Beck 2013.
(4) Osterhammel, Jürgen: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München: C.H.Beck 2009, S. 13.
(5) Schui, Herbert: Politische Mythen und elitäre Menschenfeindlichkeit. Halten Ruhe und Ordnung die Gesellschaft zusammen? Hamburg: VSA 2014, S. 51.
(6) Zwei der besten Studien hierzu sind: Eichler, Lutz: System und Selbst. Arbeit und Subjektivität im Zeitalter ihrer strategischen Anerkennung. Bielefeld: transcript 2013; Marchart, Oliver: Die Prekarisierungsgesellschaft. Prekäre Proteste. Politik und Ökonomie im Zeichen der Prekarisierung. Bielefeld: transcript 2013.
(7) Osterhammel, Jürgen: Die Flughöhe der Adler. Historische Essays zur globalen Gegenwart. München: C.H.Beck 2017, S. 142-159.
(8) Thomä, Dieter (Hg.): Heidegger-Handbuch. Stuttgart: J.B. Metzler 2013, S. 97.
(9) Sloterdijk, Peter: Sphären III. Schäume. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004, S. 729f.
(10) Rosa, Hartmut: Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung. Berlin: Suhrkamp 2016.
(11) Distelhorst, Lars: Leistung. Das Endstadium der Ideologie. Bielefeld: transcript 2014, S. 113.
(12) Überaus lesenswert hierzu der Essay des Badiou-Schülers: Garcia, Tristan: Das intensive Leben. Eine moderne Obsession. Berlin: Suhrkamp 2017.

Wenn Sie für unabhängige Artikel wie diesen etwas übrig haben, können Sie uns zum Beispiel mit einem Dauerauftrag von 2 Euro oder einer Einzelspende unterstützen.
Oder senden Sie einfach eine SMS mit dem Stichwort Manova5 oder Manova10 an die 81190 und mit Ihrer nächsten Handyrechnung werden Ihnen 5, beziehungsweise 10 Euro in Rechnung gestellt, die abzüglich einer Gebühr von 17 Cent unmittelbar unserer Arbeit zugutekommen.