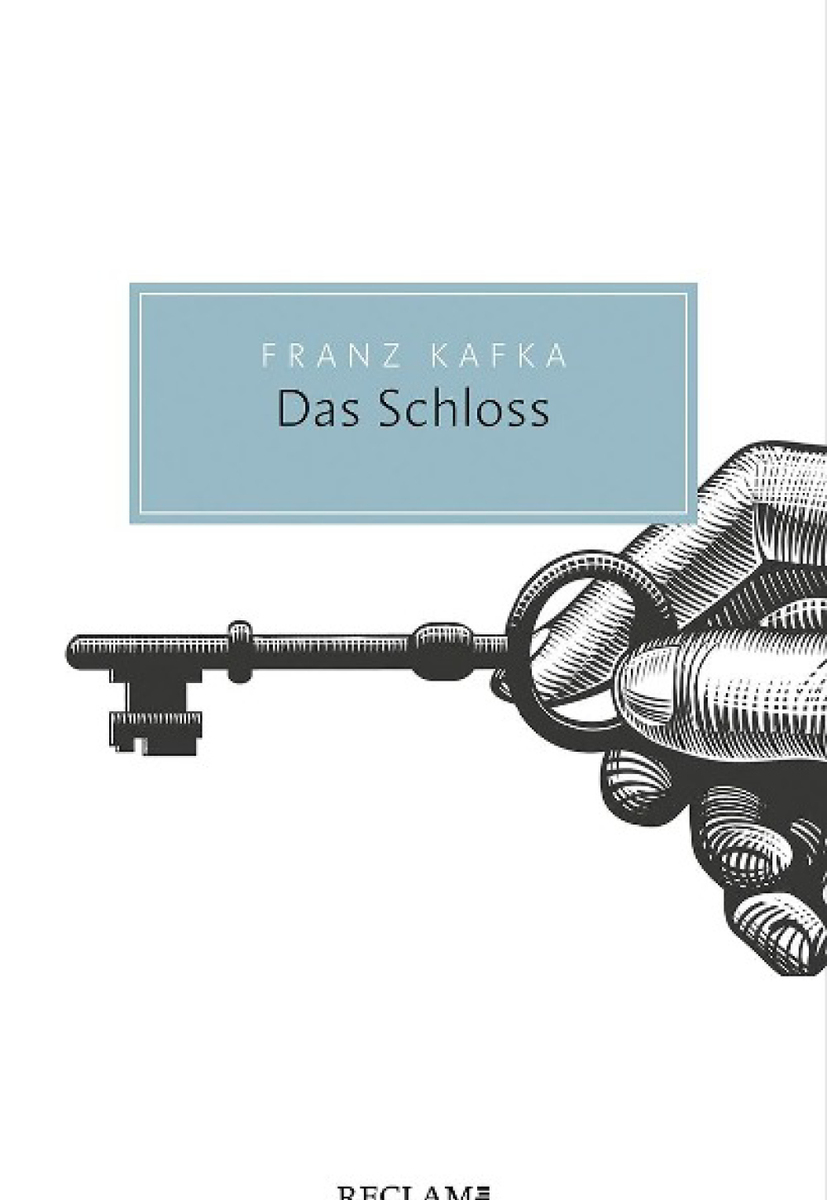Unvollendet, aber vollkommen
Franz Kafka, der vor hundert Jahren starb, schuf mit „Das Schloss“ eine Parabel auf die Verlorenheit des modernen Menschen, der in Konfrontation mit einem überwältigenden „Apparat“ scheitert.
2024 jährt sich der Todestag Franz Kafkas zum 100. Mal. Ein Anlass, Kafkas „Das Schloss“ noch einmal zu lesen. Wer diesen Roman auf sich wirken lässt, gerät sofort in seinen Bann. Und wer ihn dann noch mit den Erfahrungen seit 2020 liest, wird ungehalten und wütend. Der literarische Analphabetismus hat auch politische und moralische Konsequenzen. Der Autor gibt eine dringende Lese-Empfehlung!
1924 stirbt Kafka. Zwei Jahre vorher hatte er Das Schloss geschrieben und es unvollendet gelassen. Max Brod, sein langjähriger Freund und späterer Herausgeber der Werke Kafkas, sprach davon, Kafka habe den Roman mit dem Erschöpfungstod seines Helden K. enden lassen wollen. Kafka hatte Das Schloss 1922 in wenigen Monaten geschrieben. Aber er gab dem Roman kein abschließendes Ende, obwohl er seit Sommer 1922 wegen seiner Erkrankung pensioniert war und noch an anderen Dingen schrieb. Ein Ende wollte sich für ihn wohl nicht einstellen. Wenn ein Werk unvollendet bleiben musste, dann Kafkas Schloss. In gewissem Sinne ist sein Unvollendetsein Teil seiner Vollkommenheit.
Endlos sind seither auch die Deutungen, die Das Schloss erfahren hat. Die Verfasser theologischer Deutungen streiten sich mit denjenigen, die das Werk psychoanalytisch, philosophisch und gesellschaftskritisch interpretatieren. Ich werde hier keine neue und schon gar keine end-gültige hinzufügen. Seit Max Brod Das Schloss 1926 posthum veröffentlicht hat, gilt es jedenfalls als Meisterwerk der Literatur. Zu Recht. Um ihm etwas abzugewinnen, braucht man keine Theorien, man muss es nur lesen und sich ihm aussetzen.
Anlässlich der 100. Wiederkehr von Kafkas Todestag habe ich Das Schloss wieder gelesen. Es hat mich gebannt auf das starren lassen, was unsere moderne Welt ausmacht. Nie vorher ist das so klar beschrieben worden.
Wer Das Schloss liest, muss wütend oder beschämt auf das blicken, was seither betrieben oder zugelassen wurde. So sind seit 2020 viele ungeheuerliche Dinge geschehen, die ohne den literarischen Analphabetismus bei Politik und ihren willfährigen Medienschaffenden kaum denkbar sind.
Kafkas Schloss ist ein epochales Werk, das die Welt in eine alte vor und eine neue nach ihm teilt. Alle, die sich seither der Herrschaft eines alles durchdringenden Schlosses ergaben, können nur anführen, dass sie Das Schloss nicht gelesen haben oder sich von ihm nicht berühren lassen wollten.
Die Macht des Schlosses
Natürlich ist alles um Kafkas Schloss rätselhaft und geheimnisvoll. Alles ist diesig. Jede Erscheinung verbirgt zugleich etwas. Im Offensichtlichen begegnet von Anfang an „scheinbar“ etwas anderes, verborgenes:
„Es war spät, als K. ankam. Das Dorf lag in tiefem Schnee. Vom Schlossberg war nichts zu sehen, Nebel und Finsternis umgaben ihn, auch nicht der schwächste Lichtschein, deutete das große Schloss an. Lange stand K. auf der Holzbrücke, die von der Landstraße zum Dorf führte, und blickte in die scheinbare Leere empor“ (1).
K. sucht im Dorf-Wirtshaus, dem „Brückenhof“, Unterschlupf. Dort freilich darf er ohne gräfliche Aufenthaltsgenehmigung aus dem Schloss nicht nächtigen. K. behauptet nun, der Graf selbst habe ihn als Landvermesser gerufen. Gibt es diesen Ruf, diese Berufung? Das „scheint“ keineswegs eindeutig zu sein. K. spricht nämlich selbst davon, sich „verirrt“ zu haben und weiß auch gar nichts von einem Schloss. Statt für einen Landvermesser wird er für einen „gemeine(n), lügnerische(n) Landstreicher“ gehalten: ein „Mann in den Dreißigern, recht zerlumpt (…) mit einem winzigen Rucksack“ (2).
Man telefoniert ins Schloss. Dort wird der Beauftragung zunächst widersprochen, um dann in einem Rückruf den Widerspruch zu widerrufen. „K. horchte auf. Das Schloss hatte ihn also zum Landvermesser ernannt.“ K scheint darüber selbst überrascht und sieht darin etwas, das „ungünstig für ihn“ sei, „denn es zeigte, dass man im Schloss alles Nötige über ihn wusste, die Kräfteverhältnisse abgewogen hatte und den Kampf lächelnd aufnahm.“
Man glaubte offenbar — so K. — durch die „Anerkennung seiner Landvermesserschaft ihn dauernd in Schrecken halten zu können“. Das ist ziemlich ungereimt. Er folgt einem Ruf, der vielleicht nie ergangen ist. Er ist einfach angekommen. Sein spätes Angekommensein ist seine Berufung, ihm ging immer schon etwas voraus, in das er sich nun einfinden muss.
K. jedenfalls beschließt am nächsten Tag, sein Da-Sein, im und mit dem Schloss zu klären. Er macht sich also dahin auf den Weg. Dabei überkommt ihn schon bald eine „Müdigkeit“. Für sein Vorhaben — „zur Unzeit“ — scheinen „übergroße Anstrengungen“ von Nöten.
„Wenn er sich in seinem heutigen Zustand zwang, seinen Spaziergang wenigstens bis zum Eingang des Schlosses auszudehnen, war übergenug getan. So ging er wieder vorwärts, aber es war ein langer Weg. Die Straße nämlich, die Hauptstraße des Dorfes, führte nicht zum Schlossberg, sie führte nur nahe heran, dann aber, wie absichtlich, bog sie ab, und wenn sie sich auch vom Schloss nicht entfernte, so kam sie ihm doch auch nicht näher.
Immer erwartete K., dass nun endlich die Straße zum Schloss einlenken müsse, weil er es erwartete, ging er weiter; offenbar infolge seiner Müdigkeit zögerte er, die Straße zu verlassen, auch staunte er über die Länge des Dorfes, das kein Ende nahm, immer wieder die kleinen Häuschen und vereisten Fensterscheiben und Schnee und Menschenleere — endlich riss er sich los von dieser festhaltenden Straße, ein schmales Gäßchen nahm ihn auf, noch tieferer Schnee, das Herausziehen der einsinkenden Füße war eine schwere Arbeit, Schweiß brach ihm aus, plötzlich stand er still und konnte nicht mehr weiter“ (3).
Das Schloss ist unerreichbar. Nicht, weil es das Schloss nicht „gibt“. Es ist einfach da. Es durchdringt alles. Das Schloss stürmen zu wollen, wäre so, als wollten wir, liebe Leser, loslaufen, um die Welt zu erreichen, die uns schon längst umgibt und bestimmt.
Das Schloss schickt – wie die Welt – Botschaften. K. erhält über einen Boten, genannt Barnabas, eine solche Botschaft: „Sie sind, wie Sie wissen, in die herrschaftlichen Dienste aufgenommen.“ Die Botschaft stammt vom „Vorstand der X. Kanzlei“, Klamm, der – wie wir erfahren werden – für das Dorfleben eine bestimmende Rolle einnimmt.
K. setzt nun alles daran, seine „Angelegenheiten“ mit ihm zu besprechen. Sie sind nicht mehr rein dienstlich, denn er hat mit Frieda, die vorgibt, die Geliebte Klamms zu sein, ein Verhältnis begonnen und sie planen gar zu heiraten. K. hat nun überdies zwischenzeitlich vom Gemeindevorsteher, an den er sich wenden sollte, erfahren, dass man keinen Landvermesser brauche und alles auf einem Verwaltungsvorgang zwischen verschiedenen Kanzleien und Abteilungen beruhe, der noch nicht abschließend verhandelt wurde. Alles sei in der Schwebe, und so sei er nun in einem Dienstverhältnis, dessen Form noch ungeklärt sei.
Die Dinge verhielten sich aber lange nicht so, wie K. sich das vorzustellen scheine: „Sie sind“, erklärt ihm der Gemeindevorsteher, „eben noch niemals wirklich mit unseren Behörden in Berührung gekommen. Alle diese Berührungen sind nur scheinbar, Sie aber halten sie infolge Ihrer Unkenntnis der Verhältnisse für wirklich.“ Wer im Schloss anrufe und dort zum Beispiel mit einem Sordini sprechen wolle, der könne sich doch niemals sicher sein, dass „es auch wirklich Sordini ist, der ihm antwortet“.
Der Kontakt mit den Behörden findet im Wesentlichen über den „Herrenhof“ statt, einen Gasthof, in dem sich Beamte des Schlosses nachts einquartieren, um dort ihre nötigen „Verhöre“ zu führen, die sie unter Aufopferung ihrer Nachtruhe und im Interesse der Dorfbewohner vornehmen, um sich über Vorgänge, die behördlich zu beurteilen sind, ein erweitertes Bild zu machen. Am Tage sind sie mit den behördlichen Dingen der Verwaltung so ausgelastet, dass ihnen nur die Nacht für die ihnen notwendig scheinenden Verhöre bleibt. Dabei empfangen sie die Dorfbewohner meist völlig übermüdet im Bett, schlafen immer wieder ein und verlassen gegen 5 Uhr morgens den „Herrenhof“ wieder Richtung Schloss. Dazu benutzen sie immer wieder andere Wege. Es ist nie vorherzusehen, wer wann und warum zu einem nächtlichen Verhör gerufen wird.
K. aber — so scheint es — hat einen persönlichen Boten, der ihm den direkten Kontakt zu Klamm zu ermöglichen scheint. Er erhält über ihn eine weitere Botschaft, die ihn endgültig verstört. Ihm wird dabei etwas zugerechnet, was er gar nicht getan zu haben glaubt:
„Die Landvermesserarbeiten, die Sie bisher ausgeführt haben, finden meine Anerkennung. (…) Lassen Sie nicht nach in Ihrem Eifer. Führen Sie die Arbeiten zu einem guten Ende“ (4). Um welche „Landvermesserarbeiten“ soll es sich dabei handeln? „Der Herr ist falsch unterrichtet“, meint K.
*„Ich mache doch keine Vermesserarbeit … Und die Arbeit, die ich nicht mache, kann ich auch nicht unterbrechen, nicht einmal die Erbitterung des Herrn kann ich erregen, wie sollte ich seine Anerkennung verdienen! Und getrost kann ich niemals sein.“ *
K. war einfach nur da und glaubt, nichts vermessen zu haben. Er ist sich keiner Vermessenheit bewusst. Er beauftragt Barnabas, den Boten, Klamm umgehend eine Antwort zu überstellen, in der er um eine direkte Unterredung bittet. Aber er ist über die Bedeutung der Botschaften und die Rolle des Boten noch im Unklaren. Klamm wartet nicht auf Antworten, „er ist sogar ärgerlich, wenn ich komme. ‚Wieder neue Nachrichten‘, sagte er einmal und meistens steht er auf, wenn er mich von der Ferne kommen sieht, geht ins Nebenzimmer und empfängt mich nicht. Es ist auch nicht bestimmt, dass ich gleich mit jeder Botschaft kommen soll, wäre es bestimmt, käme ich natürlich gleich… Wenn ich eine Botschaft bringe, geschieht es freiwillig“ (5).
Aber auch das beschreibt seine Rolle nicht richtig. Barnabas ist der Bruder von Amalia, die sich vor Jahren obszöner Forderungen eines höheren Beamten entzogen hatte. Sie hat in den Augen der Dorfbewohner gegen das Schloss revoltiert. Seither ist die Familie im Dorf geächtet. Sie wird ausgegrenzt und unterliegt der sozialen Verbannung. Ihr Verhalten wird von den Dorfbewohnern verurteilt, ohne dass behördliche Sanktionen von Seiten des Schlosses erfolgt wären. Die Bemühungen der Familie, sich bei den Behörden zu verteidigen, müssen zwangsläufig scheitern, weil die Behörde selbst sich offenbar gar nicht betroffen wähnt. Barnabas, als Teil der geächteten Familie vom Unwillen des Dorfes zur Untätigkeit verurteilt ist, flüchtet sich in den Botendienst, der „immerhin eine Art Schlossdienst (ist), so sollte man wenigstens glauben“ (6).
Sein Botendienst ist von besonderer Art. So hat er zum Beispiel keine Livree. Sie sei „ihm zugesichert worden, aber in dieser Hinsicht ist man im Schloss sehr langsam und das Schlimme ist, dass man niemals weiß, was diese Langsamkeit bedeutet; sie kann bedeuten, dass die Sache im Amtsgang ist, sie kann aber auch bedeuten, dass der Amtsgang noch gar nicht begonnen hat, dass man also zum Beispiel Barnabas immer noch erst erproben will, sie kann aber schließlich auch bedeuten, dass der Amtsgang schon beendet ist, man aus irgendwelchen Gründen die Zusicherung zurückgezogen hat …“ (7).
Was für Barnabas’ Anliegen gilt, das gilt auch für K.s Sache. Zusicherungen, die man glaubt erhalten zu haben, sind alles andere als sicher. Und das lässt die Familie, Barnabas — und natürlich auch uns — „besonders in trüben Stunden (…) an allem zweifeln. Ist es überhaupt Schlossdienst, was Barnabas tut, fragen wir dann“ (8). Barnabas geht in Kanzleien, ohne freilich zu wissen, was das für Kanzleien sind. Manches darf er, manches nicht, und von dem meisten weiß er gar nicht, dass es existiert und es ihm verschlossen ist.
„Und dann geht der Zweifel weiter, man kann sich gar nicht wehren. Barnabas spricht mit Beamten, Barnabas bekommt Botschaften. Aber was für Beamte, was für Botschaften sind es? Jetzt ist er, wie er sagt, Klamm zugeteilt und bekommt von ihm persönlich Aufträge. Nun, das wäre doch sehr viel, selbst höhere Diener gelangen nicht so weit, es wäre fast zuviel, das ist das Beängstigende. Denk nur, unmittelbar Klamm zugeteilt sein, mit ihm von Mund zu Mund sprechen. Aber es ist doch so? Nun ja, es ist so, aber warum zweifelt denn Barnabas dann, dass der Beamte, der dort als Klamm bezeichnet wird, wirklich Klamm ist.“
Niemand im Dorf kann darin sicher sein, wie Klamm aussieht und wer es ist. Tatsächlich wartet Barnabas in den Vorzimmern der Kanzleien tage- und wochenlang darauf, eine Botschaft zur Zustellung zu bekommen, die ihm dann ein Schreiber zuwirft: „Von Klamm für K.“
K. will darin keinen Grund für Zweifel an der Bedeutung der behördlichen Botschaften erkennen. Und auch dass Barnabas ihm anvertraute Botschaften erst „nach einiger Zeit“, „es können Tage und Wochen inzwischen vergangen sein“, zustellt, lässt K. nicht am behördlichen Vorgehen zweifeln. Schließlich wird aber klar, dass Barnabas in einem ausgezeichneten Sinne der persönliche Bote K.s ist. „Vor einer Woche“, wird ihm von der Schwester des Barnabas offenbart, „bist du gekommen. Ich hörte im Herrenhof jemanden es erwähnen, kümmerte mich aber nicht darum; ein Landvermesser war gekommen; ich wusste nicht einmal, was das ist.“
Am nächsten Abend kam Barnabas völlig aufgelöst mit seiner ersten Botschaft, die er bestellen sollte.
„Es ist, als hätte sich vor ihm plötzlich eine ganz neue Welt aufgetan ... Und dabei ist ihm nichts anderes geschehen, als dass er einen Brief an dich zur Bestellung bekommen hat. Aber es ist freilich der erste Brief, die erste Arbeit, die er überhaupt je bekommen hat“ (9).
Es war mit K. auch eine Botschaft für ihn angekommen. Das Schicksal des Barnabas ist mit dem von K. aufs Engste verbunden. Barnabas, so heißt es, „hat etwas von Amalia im Blut“, (10) der Schwester, die sich gegen die Selbstverständlichkeit der Schloss-Ordnung wandte. Es ist etwas, das wie das Dasein K.s, aus der herrschaftlichen Ordnung des Schlosses fällt, die sich im Leben des Dorfes zeigt.
Barnabas wird K. noch eine Botschaft bringen, diesmal von einem der Sekretäre Klamms. Er möge umgehend in den „Herrenhof“ kommen, wo der Sekretär Erlanger bis um fünf Uhr morgens einige der typischen Nachtverhöre durchführe. Erlanger wird ihn zu etwas auffordern, was bereits Realität erlangt hat. Er soll Frieda, die er heiraten wollte, aufgeben und in den „Herrenhof“ zurückschicken. Frieda freilich hatte ihn bereits wieder verlassen und war in den Dienst im „Herrenhof“ zurückgekehrt. Die Botschaft ist nur Ausdruck seines Daseins. Während seines nächtlichen Aufenthalts im „Herrenhof“ gewinnt er aber durch sein eigenmächtiges Umherirren einen unmittelbaren Einblick in die Unsinnigkeit des alles durchdringenden behördlichen Getriebes. Er wird schließlich von einer Müdigkeit überwältigt.
Nach langem Schlaf erwacht er „in der Zufriedenheit, endlich einmal ausgeschlafen zu sein“. Das Zimmermädchen Pepi kümmert sich um ihn. Sie klagt ihm ihr Leid, denn nun, nachdem Frieda, K.s kurzzeitige Verlobte, wieder ihren Dienst im „Herrenhof“ aufnimmt, muss sie in ihr unglückliches Dasein als Zimmermädchen zurück. Glücklich würde sie derjenige machen, der „die Kraft hätte, den ganzen Herrenhof anzuzünden und zu verbrennen, aber vollständig, dass keine Spur zurückbleibt, verbrennen wie Papier im Ofen“ (11). Aber das ist nicht in Sicht, und auch K. ist dazu nicht in der Lage. Sie müssen sich in ihr Dorf-Leben einfinden. K. ist nun allerdings auch ein Ausgestoßener.
Ich bin, klagt er, „fast beschäftigungslos, bin müde, habe Verlangen nach immer vollständigerer Beschäftigungslosigkeit“ (12) und fragt das Zimmermädchen um Rat. Und die, die gerade noch über ihr Leben geklagt hatte, das sie, in allem beengt, mit zwei anderen Zimmermädchen in einem kleinen, kargen Zimmerchen verbringen muss, rät K. nun, bei ihnen Zuflucht zu nehmen. „Niemand wird von dir wissen, nur wir drei. Ah, es wird lustig sein. Schon kommt mir das Leben dort viel erträglicher vor als vor einem Weilchen noch“ (13). Man könne eng aneinandergedrückt so leben, „als könne außerhalb des Zimmers eigentlich nichts geschehen“, gleichsam in Quarantäne. „Komm, oh bitte, komm zu uns!“
Noch bevor er auf die Frage „Kommst du also?“ (14) antworten kann, öffnet sich die Tür und die Wirtin des „Herrenhofes“ kommt herein. Sie müsste K. eigentlich hinauswerfen. Aber sie verwickelt sich in ein Gespräch über ihre Kleidung, weil sie glaubte, dass K. die „Keckheit“ besaß, „etwas über mein Kleid zu sagen“. Tatsächlich trägt sie nach K.s Auffassung unpassende, ihr eigentlich fremde Kleider. Sie führt ihn schließlich in ein Zimmer, in dem ein riesiger Schrank „voll von Kleidern ist“.
„Das sind meine Kleider, alle veraltet, überladen, wie du meinst. Es sind aber nur die Kleider, für die ich oben in meinem Zimmer keinen Platz habe, dort habe ich noch zwei Schränke voll, zwei Schränke, jeder fast so groß wie dieser“ (15). K. behauptet ähnliches erwartet zu haben.
„‚Ich ziele nur darauf ab, mich schön zu kleiden‘“, bekennt die Wirtin, „‚und du bist entweder ein Narr oder ein Kind oder ein sehr böser, gefährlicher Mensch. Geh, nun geh schon!‘ K. war schon im Flur (…), als die Wirtin ihm nachrief: ‚Ich bekomme morgen ein neues Kleid, vielleicht lasse ich dich holen‘“ (16).
Damit endet Das Schloss. Man kann sich kaum einen schöneren Schluss vorstellen.
„Böse, gefährliche Menschen“
Als Narren oder sehr böse, gefährliche Menschen gelten von alters her diejenigen, die von den falschen Kleidern ihrer „dörflichen“ Zeitgenossen sprechen. Es sind freilich auch nicht alle Zeitgenossen darum bemüht, sich „schön zu kleiden“. Es sind die Wirte und Wirtinnen, die Diener und Lakaien, die behördliche Dienste leisten und diese sichtbar gemacht und anerkannt wissen wollen. Die meisten folgen, ohne groß Aufhebens zu machen, der Macht des Schlosses.
Der Unheimlichkeit dieser Macht werden nur „Außenseiter“ gewahr, die nicht „immer schon“ ihr Dasein als verschlossenes verstehen, eines, das sich in Form des Schlosses ausprägt.
Der Ankömmling K. möchte sich mit dem Schloss ins Benehmen setzen, weil er es (noch) als etwas anderes als seiner selbst wahrnimmt, etwas das ihm gegenübersteht, dem er begegnen kann und zu dem er sich positionieren will. „Meine Angelegenheiten mit den Behörden in Ordnung zu bringen“, sagt K., „ist mein höchster, eigentlich mein einziger Wunsch“ (17). Das bestimmt auch die Dorfbewohner, aber sie stehen mit dem Schloss in einem anderen Verhältnis.
Die Ordnung des Schlosses ist eine von den Dorfbewohnern erlebte Übermacht, der sie nicht entrinnen können. Sie sind darin eingeschlossen. Sie können sich von ihm nicht trennen, weil es zu ihrem Wesen gehört und es in einem gewissen Sinne ausmacht. Es ist nichts, was ihnen entgegensteht. Es ist ihr Gemeinwesen, das sie dennoch als fremde Übermacht durchdringt (18). Ihr Wesen ist ihnen fremd und un-heimlich geworden. Es ist etwas, von dem sie sich nicht distanzieren können, das sie aber gleichwohl als eine Macht erleben, die ihnen entgegentritt. Sie folgen dem, was sie verfolgt. Diese Folgsamkeit macht das eigene Leben aus.
Das Leben gewinnt Züge eines Traums. Der träumende Schläfer wird durch den eigenen Traum bestimmt, dem er hilflos ausgeliefert ist. Er macht sein Traumdasein aus. Das zeigt sich vor allem im Alptraum. Dort wendet sich das Ureigenste gegen den Träumer. Das Leben ist ein nicht enden wollender Alptraum besonderer Art.
Er ist ohne Dramatik. Eine dramatische Zuspitzung würde uns zum Aufwachen zwingen. Aber wir fallen von keiner Klippe und werden von keinem Drachen gepackt. Es sind Träume, die uns durch ihr Nicht-zum-Ende-Kommen, durch ihren immer wieder erneuerten Aufschub quälen: Wir wollen irgendwo hin, jemand wartet auf uns, wir kommen einfach nicht voran. Wir wollen ankommen und die Erwartung erfüllen, aber immer wieder kommt etwas dazwischen, verzögert sich, hält uns auf. Es geschieht nichts Großes. Es ist das Kleine, das Schleichende, das dann die gute Absicht erneut durchkreuzt.
Der Traum ist immer unser Traum, und wir sind ihm dennoch ausgeliefert. Weil wir über uns und unsere Welt Bescheid wissen, tun es immer auch die, die uns begegnen. Im Traum können wir uns nicht verstecken — alles liegt offen zutage und ist dennoch nicht frei zugänglich. Über K. wissen alle, denen er begegnet „immer schon“ so weit Bescheid, wie es der Sache entspricht. Sie wissen, was er weiß, weil sie sein Umgang sind. Seine Welt ist eine, die er nicht gemacht hat, die aber seine ist, insofern er in ihr lebt. Seine Welt ist sein Dasein, seine Existenz. Wie könnte sie nicht durch das bestimmt sein, was ihn ausmacht?
Welcher Art sind zum Beispiel die nächtlichen „Verhöre“, die obrigkeitliche Herren schlaftrunken und übermüdet in ihren Betten führen? Wer spricht da nächtlich zu wem? Die Dorfbewohner sehen sich „Verhör“-Fragen ausgesetzt, die von Dingen herrühren, die noch keinen Abschluss gefunden haben, von Liegengebliebenem und noch Unaufgearbeitetem, und ihnen Antworten abnötigen.
Einer fremden Macht könnte man wach entgegentreten, sich von ihr distanzieren und ihr zu entkommen suchen. Aber die Macht des Unheimlichen sind wir selbst, sie wirkt in uns. Wir entkommen ihr nicht, weil wir ihr ganz verfallen sind.
Personen sind frei, weil sie sich im Anderen erkennen können, ohne doch mit ihm eins zu sein. Personen teilen handelnd und sprechend eine Welt. Kafkas Dorfbewohner sind ihr verfallen. Alles schließt sich um sie ab. Adorno wird das später Verblendungszusammenhang nennen. Wer sich Kafkas Schloss lesend aussetzt, darin etwas Wahres und Epochales erkannt haben will, und gleichwohl den um uns errichteten Schlössern nicht entgegentritt oder ihnen gar dient, dem bleibt nur, beschämt an sich selbst zu zweifeln.
Natürlich kann man glauben, dass das, was Kafka da erzählt, nichts mit uns und unserer Welt zu tun hat. Von K. heißt es: „Flüchtig erinnerte sich K. an sein Heimatstädtchen; es stand diesem angeblichen Schlosse kaum nach“ (19). Nicht jeder wird sich und seine Heimat wie K. flüchtig darin erkennen.
Kafkas Schloss ist ein epochales Ereignis und bringt Wesenszüge der Moderne ins dichterische Wort, die sich auch in anderen Werken der Zeit zeigen. Um die Größe Kafkas richtig zu verstehen, empfiehlt sich der Vergleich mit den „Helden“ der offiziellen Literatur — zum Beispiel den Literatur-Nobel-Preisträgern von 1900 bis 1924. Kein einziger erreicht auch nur im Ansatz die Größe einer einzigen Kafkaschen Erzählung; es sind allenfalls Wortführer einer literarischen Schöngeistigkeit, der der Anstrich von bedeutsamer Kultur gegeben werden soll.
Um die epochale Bedeutung von Kafkas Schloss richtig einordnen zu können, muss man sie an Freuds Traumdeutung von 1900, Wittgensteins im Ersten Weltkrieg entstandenem und 1922 veröffentlichten Tractatus oder Heideggers 1927 erschienenem Sein und Zeit halten. Und mit diesen teilt er das Ringen ums Verständnis dessen, was für uns die Zumutung der Modernen Zeiten (Modern Times) ausmacht.
1922 — im Jahre des Entstehens des Schlosses — erscheint auch Max Webers Wirtschaft und Gesellschaft. Dort heißt es „Jede Herrschaft äußert sich (…) als Verwaltung“ (20). Während Max Weber der Verwaltung als Zeichen von Modernität durchaus etwas abgewinnen konnte, er sah darin nicht ganz zu unrecht die Entkoppelung von Macht und politischer Ideologie, erkannte er zugleich die Gefahr der technokratischen Entpolitisierung. Bei Kafka gewinnt sie einen existentiellen Sinn. „Nirgends noch hatte K. Amt und Leben so verflochten gesehen wie hier, so verflochten, dass es scheinen konnte, Amt und Leben hätten die Plätze gewechselt.“
Nicht jeder wird die Bedeutung Kafkas für das moderne Selbst- und Weltverständnis so sehen. Es gibt unverbesserliche Optimisten. Sei es, dass die bitterliche Kälte ihrer Behausungen oder die Überhitzung ihrer Dienststuben sie taub und blind macht. Einen Zugang zu diesem Schloss zu finden, ist ohne Sorge ums eigene Dasein wohl auch nicht möglich. Man muss gedanklich draußen sein, damit es sich erschließt.
„Lass die Deutungen!“, lässt Kafka seinen K. sagen (21). Wir sind — „wie Sie wissen“ — „in die herrschaftlichen Dienste aufgenommen“. Vom „Brückenhof“ führt auch unser Weg in den nächtlichen „Herrenhof“ und zum verzweifelten Ringen um Klamm – der Name ist Programm (22).
Es bleibt die bedrückende Offenbarung der Lektüre, die jedem empfohlen sei. Sie lässt uns, die wir Kafka etwas abgewinnen können, mit der Erkenntnis zurück: Wir hätten es wissen können. Eigentlich wussten wir es auch. Nicht erst seit Snowden.
Hier können Sie das Buch bestellen: „Das Schloss“