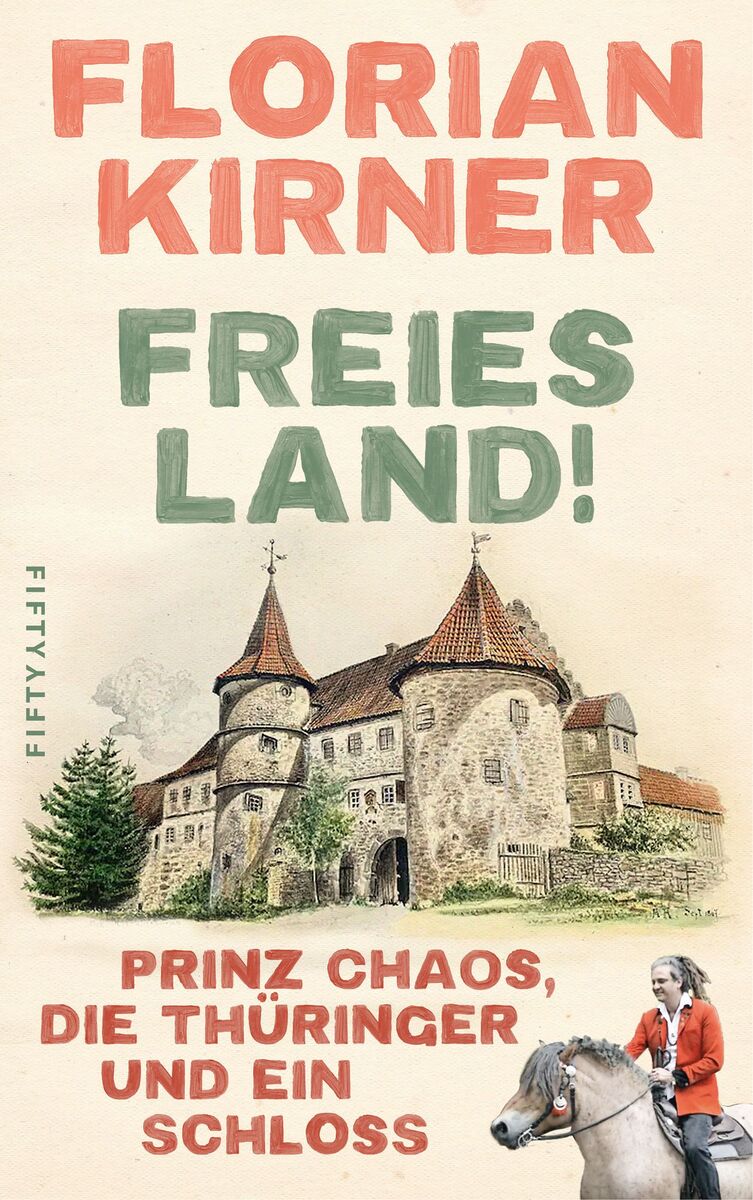Geschlossene Freiräume
Von seinem Südthüringer Schloss aus wagt der als Prinz Chaos II. bekannte Florian Kirner mit „Freies Land!“ einen autobiografischen Ritt durch die Merkel-Ära und die (Post-)Coronazeit mit Weitblick und toten Winkeln.
Im Januar 2008 erwarb der bayerische Prinz Chaos II. ein altes Ritterschloss im südthüringischen Weitersroda bei Hildburghausen. 17 Jahre später veröffentlicht das Staatsunterhaupt mit dem bürgerlichen Namen Florian Kirner in autobiografischer Buchform einen „Bericht von einem, der auszog, in der innerdeutschen Fremde eine Heimat zu finden“, und das „fernab von Wessi-Klischees und ostdeutscher Nostalgie“. So verspricht es der Buchdeckel von „Freies Land!“. Doch lassen sich mit einer modernen Legende aus Südthüringen 300 Seiten füllen, die auch überregional das Interesse einer Leserschaft zu wecken vermögen? In Zeiten, da Wahlergebnisse und „Impf“-Quoten die ehemaligen innerdeutschen Grenzen wieder sichtbar werden lassen, kann dieses Werk zweifelsohne eine gewisse Aktualität für sich beanspruchen. Mit dem Untertitel „Prinz Chaos, die Thüringer und ein Schloss“ beinhaltet das Buch naturgemäß eine gewisse Nabelschau des exzentrischen Verfassers. Nichtsdestotrotz bekommt der Leser eine lebhafte Rückschau in das (Mittel-)Deutschland der Merkel-Ära. Es ist ein tragikomisch geschriebenes Buch über Bürokratismus, Freiheitsstreben, gescheiterte und geglückte Wohngemeinschaften, realisierte Träume, Illusionen und die soziale Reibungshitze zwischen Ost und West, Provinz und Stadt. Die dabei immer mitschwingende Ironie des Ganzen ist dem Titel eingeschrieben. Denn das Werk zeichnet 17 Jahre lang den deutschen Pfad in eine Richtung nach, in der die Bundesrepublik eines ganz gewiss nicht mehr ist: ein freies Land.
Der Name Prinz Chaos mag jenen noch ein Begriff sein, die freie und alternative Medien (was ich im Folgenden mit FAM abkürze) nicht erst seit Corona rezipieren. In der Tat war das selbst ernannte Staatsunterhaupt, der Liedermacher, Aktivist, Kabarettist und studierte Amerikanist Kirner, zwischen 2014 bis 2019 im Spektrum der FAM reichlich präsent, ehe er sich 2020 mit Corona „umorientierte“. Ein halbes Jahrzehnt nach seinem Rückzug aus dem Kosmos der FAM macht er mit seinem autobiografischen Werk „Freies Land! Prinz Chaos, die Thüringer und ein Schloss“ überregional auf sich, sein Schloss Weitersroda und seine Wahlheimat Hildburghausen aufmerksam.
Wer mag wohl die Zielgruppe dieses Werks sein? Das ist die übergeordnete Frage, die sich durch diese Rezension ziehen wird. Welche Bewandtnis hat dieses Buch für Menschen, die südlich von Coburg, östlich von Eisfeld, nördlich von Suhl und westlich der Röhn wohnen oder sogar leben und/oder keinen Bezug zu diesem Schloss haben? Der persönlicher Bezug zu diesem Ort ist für mich als Rezensent die Tatsache, dass ich zwischen 2016 und 2020 — alle verschiedenartigen Besuchsanlässe addiert — weit über einen Monat auf Schloss Weitersroda verbracht habe. Ich kenne das Schloss und die drumherum befindlichen Ländereien sehr gut. Doch für wie viele Menschen gilt das noch? Wie viele Menschen in diesem Land haben irgendeinen Bezug — ob einen guten oder einen schlechten — zu diesem Bauwerk? Und wer von denen, die keinen haben, hätten einen Grund, dies zu ändern? Diese Frage heben wir uns für das Ende auf und wenden uns nun dem Werk zu.
Ein Schloss in Bürokratistan
In Zeiten, da Buchcover zum maßgeblichen Entscheidungsfaktor für den (Miss-)Erfolg von Büchern geworden sind, kommt „Freies Land!“ mit seiner historischen Schlosszeichnung auf der Buchfront vergleichsweise unaufgeregt daher. Entsprechend beginnt das Werk nicht mit einer spröden Beschreibung der Immobiliensuche, sondern mit dem erzählerischen Vorgriff eines einprägsamen Erlebnisses des neuen Schlossherren: ein Nazi-Angriff auf Schloss Weitersroda im Einzugsjahr 2008. Dem Leser wird damit auf den ersten Seiten vermittelt: In dem kleinen Dorf Weitersroda fliegen nicht nur Heuballen, sondern auch mal Fäuste. Und damit wird er direkt hineingeworfen in das innerdeutsche Spannungsfeld zwischen Ost und West, zwischen ländlichen und urbanen Raum. Rückblickend aus dem Jahr 2025 wird sichtbar, was hierzulande bereits in den Nullerjahren gärte, um jetzt in den 2020ern seine bizarren Stilblüten zu entfalten. Doch dazu später mehr.
Nach dem heroischen „Cold Opening“ beginnt der Prinz chronologisch zu erzählen, was ihn als weltoffenen Bayer nach unzähligen Wohnortswechseln zwischen Köln und Japan dazu bewog, sich ein altes und hochgradig sanierungsbedürftiges Schloss im Süden Thüringens, nahe der nordbayerischen Grenze zu kaufen. Wie bei fast allen Städtern, die sich auf Landflucht begeben, war es auch beim Prinzen die Enge und die Entfremdung, die den Anstoß gaben, das Weite im Grünen zu suchen. Im Konkreten lauteten die Suchwörter „Thüringen“, „unter 100.000 Euro“ und „besondere Immobilie“. Das zu diesen Konditionen erwerbbare Schloss Weitersroda bei Hildburghausen bildete für den seit Kindheitstagen burgenvernarrten Florian Kirner ein „Match“, wie man neudeutsch sagen würde.
Das erste Fünftel des Buches ist ein Exkurs in Denkmalschutz und Gebäuderestauration sowie ein Ritt durch die Welt der unterschiedlichsten Behörden, der wider Erwarten recht amüsant ausfällt. Das ist nicht zuletzt dem unnachahmlichen Kabarett-Schreibstil Kirners zu verdanken.
Mit Ironie, augenzwinkernden Übertreibungen, unverbrauchten Formulierungen und eigentlich unausdenkbaren Wortneuschöpfungen läuft das Buch auf der Formebene nie Gefahr, zu trocken zu werden. So wird selbst den naturgemäß eher unspektakulären Behördengängen Witz und Farbe eingehaucht.
Wer glaubt, es gebe etwa keine Kaufverträge über null Euro, der wird auf den ersten Seiten eines Besseren belehrt. Kirner zeigt, dass Beamte am Ende Menschen sind, mit denen man fast immer sprechen kann, ja die auch menschlich sind, selbst wenn die Schriftsätze wirken, als wären sie von einer seelenlosen Maschine verfasst worden. Leider — und das ist in diesem Buch ein Manko — fehlt immer wieder die gegenwartsbezogene und zukunftsgerichtete Meta-Perspektive. Der Autor hebt den menschlichen Faktor in den Behördenmaschinerien hervor, ohne darauf hinzuweisen, dass dieser durch ein in Deutschland vielfach herbeigesehntes DOGE-Pendant auf KI-Basis auszusterben droht. Mit dem Versäumnis, zu den Erzählungen ab 2008 einen Gegenwartsbezug herzustellen, verpasst Kirner immer wieder die wertvolle Chance, dem Gesamtwerk eine relevanzsteigernde Aktualität zu verleihen.
Ein weiteres, elementares Versäumnis gibt es auf der Formebene: Das im Buchmittelpunkt stehende Schloss wird an keiner einzigen Stelle grafisch mit Fotos, Zeichnungen und Bauplänen dargestellt. Zwar gibt es zu Beginn des Buches eine fast schon autistisch detaillierte Beschreibung des Schlosses und des umliegenden Landes. Dabei setzt Kirner allerdings ein außergewöhnlich ausgeprägtes, plastisches Vorstellungsvermögen all jener Leser voraus, die das Schloss noch nie zuvor besucht haben. Ich als jemand, der schon 13-mal an Ort und Stelle gewesen bin, kann mir all die beschriebenen Räumlichkeiten fotorealistisch vergegenwärtigen. Doch einem ortsfremden Leser bleibt nichts anderes übrig, als die Bilder des Schlosses zu googlen. Das ist bedauerlich, denn bei einem Kaufpreis von immerhin 25 Euro hätte man eine Bilderreihe mit Panorama-, Nah- und Drohnenfotografien durchaus erwarten können.
Integration, „Heinze“, der Winter und die Feste
An Dynamik gewinnt das Buch, wenn Kirner seine Integrationsgeschichte im kleinen Dorf Weitersroda zum Besten gibt. Zieht ein westdeutscher, städtischer Liedermacher, der mit 16 sein Coming-out hatte, in die Thüringer Provinz, so ist der Zusammenstoß zweier Welten vorprogrammiert. Mit mal amüsanten, mal tragischen Anekdoten schildert der Prinz seine Integrationsversuche, deren Erfolg sich langfristig als eher durchwachsen erweisen sollten, mit leichter Tendenz zu „gelungen“.
Die innerdeutsche Konfliktlinie und das beidseitige Unverständnis, welches gerade heute vielfach zu beobachten und zu spüren ist, wird in den Geschichten aus Weitersroda wie unter dem Brennglas sichtbar.
Eine besondere Rolle spielen hierbei die sogenannten „Heinze“. Für Kirner ist das ein Kollektiv-Synonym für alle Menschen, die ihm feindlich gesinnt sind. Anstandshalber entschuldigte er sich bei allen aufrichtigen Menschen mit dem Namen Heinz, die durch diese Namensverklammerung drohen, in Ungnade zu fallen. Im Laufe des Buches sammeln sich da so einige von diesen Heinzen an: feindselig gestimmte Dorfbewohner, Neonazis und auch so einige Schlossbewohner, die sich über die Jahre eingemietet haben, um irgendwann gefrustet dem Schloss den Rücken zu kehren. Die in Rausschmissen mündenden Dramen füllen hierbei mehrere Dutzend Seiten.
Ebensolche Seitenfüller sind die wirklich ernsten Konflikte mit der regionalen Neonazi-Szene. Gemeint sind damit echte Nazis, die Autos anzünden, und nicht solcherlei Menschen, die eine „falsche“ Meinung haben oder die „falsche“ Partei wählen.
Dieser Konflikt zwischen dem Schlossherrn und den verlorenen Seelen vom rechten Rand schaukelt sich im Frühling 2012 zu seinem vorläufigen Höhepunkt hoch, den man noch heute bei Google Trends einsehen kann. Nachdem die damals noch dominanten Leitmedien von der Drangsalierung des Schlosses durch Neonazis Wind bekamen, geriet das kleine Dorf in das Zentrum der Negativberichterstattung. Die gab seinerzeit einen kleinen Vorgeschmack auf die Hetze gegen Ostdeutsche, die in den Jahren ab PEGIDA noch folgen sollte. Leider tritt auch hier wieder das Manko auf, dass keine Verbindung zur heutigen Situation hergestellt wird.
Als ein „Heinz“ von höherer Gewalt erweist sich wenige Kapitel zuvor der erste Winter 2008/09 im Schloss. Dieser war — wer sich noch erinnern kann — besonders gnadenlos unerbittlich, was umso mehr an die Substanz geht, wenn man in einem schlecht isolierten und kaum warm zu bekommenden Gemäuer lebt, wie es Schloss Weitersroda zu dieser Zeit war. Mit dem weiter oben schon lobend erwähnte Schreibstil wird aus der Banalität eines kalten Winters ein geradezu sibirisches Survival-Abenteuer in Deutschland.
Neben den vielen Unannehmlichkeiten gibt es aber auch sehr ausgeschmückte Erzählungen über die vielen Festivitäten auf dem Schloss, auch und gerade über das wohl bekannteste, nämlich das sogenannte Paradiesvogelfest, welches seit 2010 fast jedes Jahr ausgetragen wird. Dazu später mehr.
Autobiografie mit Giftschränken
Das Buch ist durch und durch als Autobiografie zu verstehen, auch wenn stets ein Bezug zu dem Schloss als Identifikationsobjekt des Prinzen besteht oder hergestellt wird. Ausschweifend ranken sich die Erzählungen um seine Herkunft aus dem borniert-konservativen Bayern, seine journalistischen Tätigkeiten, den versuchsweisen Aufstieg zum beruflichen Weltrevolutionär, die vielen zerronnenen Liebschaften, die verschiedenartigsten Vater-Sohn-Prozesse sowie innerseelische Entwicklungen.
Bei dem stolzen Alter von einem halben Jahrhundert, welches Prinz Chaos diesjährig erreichte, mag das Schreiben einer Autobiografie nahe liegen. Doch stellt sich auch hier die Frage, wer genau die Zielgruppe für eine solche Autobiografie sein mag? Während zu Beginn des Buches die Verschmelzung zwischen der Kunstfigur Prinz Chaos II. und dem Bürger Florian Kirner betont wird — so steht etwa selbst in Kirners Personalausweis „Prinz Chaos II.“ —,wird im hinteren Teil des Buches freimütig offengelegt, dass Kirner die Prinzenrolle samt Musikerdasein im Zuge seiner Hildburghausener Bürgermeisterkandidatur in den Hintergrund rücken ließ. Und in der Tat hat in den 2020ern die über Thüringen hinausgehende (Medien-)Präsenz des chaotischen Prinzen stark nachgelassen, während die regionale Präsenz des Bürgerlichen Florian Kirner stark zugenommen hat, wie sich etwa aus Google Trends ablesen lässt. Wer sich in schnelllebigen Zeiten wie diesen mit seiner bekanntesten Rolle für mehr als ein halbes Jahrzehnt zurückzieht, läuft dabei unweigerlich Gefahr, in Vergessenheit zu geraten.
Der Name „Prinz Chaos“ hat auf Google Trends den größten Ausschlag im Mai 2014. Wer mit einem politischen und kalendarischen Langzeitgedächtnis gesegnet ist, kommt schnell dahinter, was sich damals zutrug: die Montagsmahnwachen für den Frieden und die Blütezeit von KenFM. Diese nicht gerade nebensächliche Etappe in der politischen Prinzenkarriere wird fast rein protokollarisch in einem überhasteten Schweinsgalopp auf wenigen Seiten abgefrühstückt. Fast schon verschämt wird zu Protokoll gegeben, dass man mal mit diesem Ken Jebsen befreundet war, während die eigene, dereinst gern genutzte Omnipräsenz auf KenFM, darunter die aufwendige Griechenland-Reise von 2015, unter den Teppich gekehrt wird. Die Zeit zwischen 2014 bis 2019 ist Kirner retrospektiv betrachtet offenkundig sehr unangenehm. Die immerhin eine halbe Dekade andauernde Karriere Kirners in den FAM wird auf gerade einmal drei von 300 Seiten heruntergerattert, was sich dann auch in Flüchtigkeitsfehlern bemerkbar macht, die in dem zahlen- und datentechnisch sonst sehr akkuraten Buch negativ hervorstechen. So heißt es etwa auf Seite 177:
„(N)achdem es 2016 eine KenFM-Sendung aus dem Schlosshof gegeben hatte, (…) setzte ein reger Schlosstourismus ein.“
Nun, die Diskussionsrunde mit dem Titel „Vor Ort die Welt retten“ wurde nicht 2016, sondern 2017 aufgezeichnet. Das wäre mit einer kurzen Google- oder Pre.Search-Suche schnell nachprüfbar gewesen.
So wird auch seine Distanzierung und Abwendung von den freien und alternativen Medien so gut wie gar nicht behandelt. Dabei würde sich dieser Sinneswandel ganz besonders für eine seitenlange Selbstreflexion eignen.
Denn ebendieser Sinneswandel fand seinen Ausdruck in einem besonderen Treppenwitz. 2019 komponierte der Prinz mit Diether Dehm den Song „Wir schwören ab“. Darin distanzierte sich das lyrische Ich von sogenannten Verschwörungstheorien. Bei seiner Entstehung war der Song als Satire gemeint. Die Vergangenheitsform sei hier explizit betont, denn das Gesungene sollte sich nach weniger als einem Jahr als selbsterfüllende Prophezeiung entpuppen…
(K)einen Zacken aus der Corona brechen: Rebellion unter Laborbedingungen
Es war der Lackmustest für jeden Kunst- und Kulturschaffenden. Die Kardinalfrage lautet: „Wo warst du zwischen 2020 und 2022?“ Kirner beantwortet die Frage wie folgt:
„Hatte ich zu Beginn der Corona-Zeit im Team Vorsicht gespielt, wechselte ich im zweiten Lockdown zu Team Stinksauer“ (Seite 233).
Die Mitgliedschaft in ersterem Team begründete den Bruch mit den FAM. Darüber findet sich im Buch kurz und knapp folgende Passage auf Seite 231:
„Zuletzt hatte ich hauptsächlich für das Magazin Rubikon geschrieben, an dessen Entstehung ich seinerzeit beteiligt gewesen war. Wir wollten eine Plattform sein, auf der inhaltliche Differenzen durch faire Debatten ausgetragen werden konnten. Anfänglich gelang das auch. Zwei Autorenkonferenzen des Rubikon (es waren drei, Anmerkung des Verfassers) fanden auf Schloss Weitersroda statt. Als Corona ausbrach (sic!), warf sich der Rubikon-Herausgeber sofort auf die Seite der Fundamentalkritiker und lehnte das Pandemie-Narrativ strikt ab. Ich spielte zu der Zeit noch für Team Vorsicht und hätte diese Debatte gerne öffentlich ausgetragen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Das wurde barsch abgelehnt. Es kam zum Bruch.“
Was hierbei geflissentlich verschwiegen wird, ist der Tonfall, mit dem Kirner diese „Debatte“ führen wollte und ebenso seine überfallartigen Anrufe, die all jene in seiner Kontaktliste ereilten, die es im März 2020 öffentlichkeitswirksam wagten, an dem offiziellen Narrativ zu rütteln.
Während Kirner ab Anfang 2020 der Mär der Jahrhundert-Pandemie das Wort redete und in vorauseilender Vorsicht die irrsinnigsten Maßnahmen auf Schloss Weitersroda durchsetzte — Unterteilung der verschiedenen Treppenhäuser für „Infizierte“ und „Nichtinfizierte“ —, mauserte er sich zum gemäßigten, aber doch tatkräftigen Corona-Rebell.
Corona vereinnahmt insgesamt fünf Kapitel des Buches, in denen diese Wandlung nachgezeichnet wird. Kirners Corona-Rebellentum weist im Laufe der Entwicklung selten eine durchgehend klare Kante auf, sondern flottiert zwischen ehrwürdigen Subversionsakten und Heldentaten einerseits und Unterordnung unter das Fake-Narrativ von einer Pandemie andererseits. Der wunde Punkt, der die Initiation für sein Aufbegehren darstellte, war neben den vielen menschlichen Tragödien das Kultursterben in den Jahren der Freiheitsberaubung, wovon er als Musiker und Festivalveranstalter maßgeblich betroffen war. Er beschreibt eindrücklich, wie seine Wut aufkeimte über das politische Degradieren von Kunst und Kultur zum systemirrelevanten „Nice to have“.
Im Zentrum seines Rebellentums steht das emsige Ringen darum, sein Paradiesvogelfest (PVF) — welches er 2020 freiwillig cancelte — 2021 auf Teufel komm raus stattfinden zu lassen. Hier zieht der Spannungsbogen des Buches noch mal deutlich an. Die eingefahrenen Erfolge, die hier in aller Ausführlichkeit beschrieben werden, können bei Coronakritikern der ersten Stunde gemischte Gefühle zurücklassen: Einerseits kann Prinz Chaos II. für sich zweifelsohne verbuchen, keiner von den suizidalen Kulturschaffenden gewesen zu sein, die sich lammfromm und regierungstreu auf die Schlachtbank der Coronapolitik haben führen lassen. Das Festival hat überlebt und ist nach diesen Jahren sogar eine noch stärkere Kulturinstitution, als sie es davor gewesen war.
Nachdem das PVF nämlich im Frühling 2021 zunächst ohne Zuschauer als Livestream-Event „ausgetragen“ worden war, wurde es im September desselben Jahres nachgeholt — allerdings unter Laborbedingungen. Der Paradiesvogel flog tatsächlich, jedoch mit einem giftigen und nutzlosen PCR-Teststäbchen im Schnabel. Es fanden tatsächlich im zweiten Coronajahr im Landkreis Hildburghausen neben dem PVF noch drei weitere Festivals statt, was diesem Landkreis seinerzeit sicherlich die höchste „Lebensfreude-Inzidenz“ in der gesamten Bundesrepublik beschert haben dürfte. Der Preis dafür war jedoch die Unterordnung unter das vollkommen sinnlose, entwürdigende, DNA-Daten raubende und obendrein ungesunde Testregime.
Im September 2021 gab es schon Unmengen an Literatur, die in aller Ausführlichkeit darlegten, warum der PCR-Test als Goldstandard der Coronalüge keine COVID-Infektion nachweisen kann. Das wurde jedoch weder dort noch nachträglich im Buch kritisch reflektiert. Dieser durchaus respektable Teilsieg der Kultur hat bei alledem einen faden, um nicht zu sagen chemischen Beigeschmack.
Nebst seinem Engagement, Kultur aufrechtzuerhalten, beschreibt Kirner weitere subversive Handlungen gegen das Coronaregime: so etwa, einen Kinderspielplatz von den unsäglichen Absperrvorrichtungen zu befreien, und digitale Foren einzurichten, in denen Menschen zu Lösungsmöglichkeiten finden konnten, um sich unter den Bedingungen des menschenverachtenden Maßnahmenregimes eine gewisse Restwürde zu bewahren. Ebenso beschreibt Kirner seine Bemühungen, Brücken zwischen den verfeindeten Lagern in einer Zeit zu bauen, da Hildburghausen durch die Entschlossenheit der Protestler und Spaziergänger in die bundesweiten Schlagzeilen geriet.
Nach anfänglicher Narrativ-Treue mauserte sich der Prinz dann doch zu einem Corona-Rebell, dem der Drahtseilakt gelang, echt subversiv gegen das Coronaregime vorzugehen, ohne in die einschlägig bekannten Ecken geschoben zu werden. Das hinterlässt, wie gesagt, ambivalente Gefühle: Einerseits hat er himmelweit mehr erreicht als jemand, der den ganzen Tag nur Links auf Telegram teilte; außerdem machte er aus seiner von Anfang an bestehenden „Impf“-Muffeligkeit keinen Hehl. Andererseits wäre es nun spätestens in einem 2025 gedruckten Buch, ein Jahr nach der Veröffentlichung der Protokolle des Robert Koch-Instituts (RKI-Files) doch an der Zeit, das Kind beim Namen zu nennen, also Corona als das zu bezeichnen, was es war: ein Jahrhundertverbrechen!
Welches freie Land? Welche Freiheit?
Nach den Corona-Kapiteln läuft das Buch in seinem Finale auf Kirners Bürgermeisterkandidatur für Hildburghausen hinaus, ehe es dann endlich darum geht, über das titelgebende „Freie Land“ zu sinnieren.
Zunächst macht der Prinz deutlich, dass nicht er es war, der dieses Land befreit hat, was ja bedeuten würde, dass das Land vorher nicht frei gewesen wäre. Doch was ist denn nun dieses freie Land? Im Grunde genommen ist das Stück Land, auf dem das Schloss steht, so (un)frei wie eh und je. Die Gemäuer befinden sich auf deutschem Staatsgebiet, die Bewohner müssen folglich alle Steuern zahlen und sich je nach Kompromissbereitschaft der Beamten an mehr oder weniger behördliche Vorgaben halten.
Tatsächlich hat Kirner mit dem Schlossprojekt relative Freiräume geschaffen. Doch wie es bei Räumen so ist, haben diese natürlich begrenzende Wände. Und in den Jahren der Fake-Pandemie blieben ebendiese Freiräume von den Schergen der Unfreiheit nicht verschont.
Zwar verwies der Prinz eindringende Truppen des Gesundheitsamtes wütend des Schlossgeländes, doch wurden auch im ersten Lockdown bestimmte Freiheitseinschränkungen von den Schlossbewohnern selbst verhängt, wie etwa die weiter oben schon erwähnte Aufteilung der Treppenhäuser für „Infizierte“ und „Gesunde“.
Wie versteht der Prinz also die Freiheit unter diesen Rahmenbedingungen? Er argumentiert mit Hegel:
„Freiheit (kann) nur in der Einheit von Person und Welt, Bürger und Staat, Mitglied und Kollektiv verwirklicht werden. Freiheit ist demnach eine Mannschaftssportart. Sie lebt von der Gemeinsamkeit und setzt eine kollektive Realität voraus, in welcher der Mensch sich selbst erkennen und mitten unter anderen Menschen ganz bei sich sein kann. Zu solchen Realitäten, die Freiheit ermöglichen, gehören bei Hegel zum Beispiel Gewohnheiten, Gebäude mit einer gemeinsamen Botschaft, eine Gemeinschaft von Freunden, die Liebe, ein idealer Staat oder Vorstellung vom guten Leben. Die Gefahr, in einen idealen Staat abzugleiten, sehe ich in Deutschland momentan nicht als akut an. Schloss Weitersroda jedoch erfüllt für mich die restlichen vorangegangenen Punkte. Deshalb nenne ich diesen Ort längst meine Heimat, und die ist (…) eine Oase der Freiheit, für mich und für viele, viele andere Menschen“ (Seite 301).
Er ist „der Auffassung, dass die Wurschtigkeit — die Buddhisten außerhalb Bayerns sprechen von Gleichmut — eine Hauptquelle der Freiheit ist“. Daraus leitet er stolz als sich selbst so bezeichnenden „Naturwissenschaftsdepp“ seine Kirner‘sche Freiheitsformel ab, die da lautet: „Lebenslust x Wurschtigkeit – Angst = Freiheit“.
Kurz bevor er die Freiheit auf diese einfache Formel gebracht hat, stellt sich bei ihm dennoch Unverständnis darüber ein, „(w)as eigentlich (…) Menschen davon ab(hält), sich weit mehr Freiheit rauszunehmen? Warum nutzen die meisten von uns viel weniger Freiheiten, als (…) möglich wäre? Warum ist die Sorge davor, was andere Leute sagen und denken könnten, oft wichtiger, als sich selbst in das Recht zu setzen, frei und ungezwungen das eigene Leben zu gestalten?“. Es ist schier ein Rätsel, warum Kirner das ein Rätsel ist. Die Kirner‘sche Freiheitsformel, die immerhin von einem links sozialisierten, denkenden und handelnden Menschen ersonnen wurde, klammert erstaunlicherweise den Faktor Ökonomie vollständig aus. Wenn dieser elementare Freiheitsfaktor nicht beachtet wird, dann nimmt es nicht wunder, dass man sich über Menschen wundert, die sich diese Freiheit nicht rausnehmen.
Weiter fragt Kirner auf Seite 299: „Ist dieses Land so frei, wie es tut? Was heißt es, frei zu sein? Muss ich mir Angela Merkels gleichnamige Memorien durchlesen, um auf 736 Seiten zu erfahren, was Freiheit ist?“ Sich durch diese 736 Seiten zu quälen, ist nicht nötig, um zu erfahren, was Freiheit ist. Es würde genügen, im eigenen Buch 257 Seiten zurückzublättern. Dann landet man ironischerweise auf Seite 42. Der 42 misst Kirner eine besondere Bedeutung zu. Nicht nur war sie der Prozentsatz seines Bürgermeisterstichwahlergebnisses, sondern sie sei — mit Verweis auf Douglas Adams — „die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“. Zu diesem ganzen Rest — wozu die offene Frage nach „unbeanspruchter“ Freiheit zählen dürfte — finden wir dann witzigerweise ausgerechnet auf Seite 42 Antworten. Wer weiß, ob sich hier das Unterbewusstsein des Verfassers einen Scherz erlaubt hat. Jedenfalls lesen wir dort:
„Mein Vater (…) schickte (…) sich drein, die von mir in diesem Heimatkampf für ihn ersonnene Rolle zu übernehmen. Bald stand das Finanzierungsmodell. Es lief darauf hinaus, dass ich erstens 25 000 Euro als vorgezogenes Erbe erhalten würde. Zweitens nähme mein Vater einen Kredit über 55 000 Euro auf. Drittens würde ein Vertrag zwischen meinem Vater und mir abgeschlossen werden, der festlegte, dass der Kredit von mir abbezahlt und die Vorauszahlung von 25 000 im Erbfall zugunsten meiner Geschwister ausgeglichen werden würde.“
„Wer ko, der ko“ („Wer kann, der kann“), wie man in der bayerischen Heimat des Prinzen zu sagen pflegt. Wo genau schlägt sich nun dieser nicht unwesentliche Wirtschaftsfaktor in seiner Freiheitsformel nieder? Nicht dass dieser allein ausschlaggebend wäre. Ein finanzielles Polster alleine, ohne Wurschtigkeit und Lebenslust und vielleicht obendrein noch mit Angst garniert, kann sogar die ideale Grundlage für die absolut gegenteilige Unfreiheit sein. Doch diese rein idealismusgeschwängerte Freiheitsformel wird der Lebensrealität nicht gerechnet. Nicht nur, aber gerade im Post-Merkel-Deutschland.
Und immerhin deckt die Merkel-Ära ziemlich genau 80 Prozent des Buches ab. Im Kapitel „Gemobbt mit 100 000 Euro“ wird das in Ansätzen auch reflektiert. Darin behandelt Kirner den Sozialneid unter den Schlossbewohnern, der sich infolge seines saftigen Erbes breitmachte. Es ist eines der vielen Kapitel, in denen der unglückliche Ausgang mit Schlossmitbewohnern behandelt wird:
„Meine Aktivistenmitbewohner bewirtschafteten immerhin viele gemeinsame Grundüberzeugungen. Das Geldsystem wurde unisono abgelehnt. Das verstehe ich. Ich bin kein Fan davon (…). Nur, was genau hieß es in der Praxis, wenn diese Leute raus aus dem Geldsystem wollten? Die Antwort lautete in fast allen Fällen: Hartz IV. Nun bin ich weit entfernt, irgendjemandem existenzielle Schwierigkeiten und die Abhängigkeit von sozialen Leistungen des Staates zum Vorwurf zu machen. Einer der eklatantesten Fälle war jedoch ein Mitbewohner aus bestens situiertem Elternhaus, mit Abitur und abgeschlossener Berufsausbildung. Er brüstete sich geradezu damit, seit Jahren Hartz IV zu beziehen. (…) (M)einen neuen Mitbewohnern (war) glasklar (…), dass altmodische Arbeitnehmerei für sie nicht infrage kam, schon weil man durch Lohnarbeit an das Geldsystem gebunden ist. Also ein Leben auf Hartz IV? Iwo! In Wirklichkeit hatten sie alle irgendeinen Plan Richtung Selbstständigkeit. (…) Nun bin ich selbstständig, seit ich mein Studium als Freelancer zu finanzieren begann. Das Projekt in Weitersroda hatte mich seither mit den gesammelten Komplexitäten des Selbstständigendaseins konfrontiert. Von daher wusste ich, dass diesen Leuten alles fehlte, was nötig ist, um als Selbstständiger zu überleben oder um auch nur die ersten Schritte in die Selbstständigkeit zu gehen. Mit dieser Voraussetzung meine ich zuallerletzt Geld. Ich meine Leidensfähigkeit, visionäre Kraft, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, immer wieder neu anzufangen“ (Seite 185).
Die Realitätsferne des besagten Mitbewohners ist vorhanden, wie ich persönlich aus erster Hand weiß. Ebenso die „charakterlichen Schwierigkeiten“. Doch müssen verlorene Seelen wie diese rausgeflogenen Schlossmitbewohner doch auch betrachtet werden als das, was die 16 Jahre Angela-alternativlos-Merkel-Politik mit Millionen Seelen in diesem Land angerichtet haben. Wurschtigkeit erlaubt das auf Effizienz getrimmte Niedriglohnland nicht, Lebensfreude erst recht nicht, und die Angst, die wird an allen Straßenecken per Zeitungsständer in die Herzen und Hirne der Menschen geimpft. Die am Ende der Gleichung stehende Freiheit existiert dann nur noch in Schriftform auf dem Merkel-Buchcover.
So werden darüber hinaus im gesamten Buch nirgends die vielen weiteren drohenden Freiheitseinschränkungen, die Corona noch einmal weit in den Schatten stellen könnten, auch nur erwähnt.
Etwa die Gefahr durch Landraub und Enteignung im Sinne der vom Nachhaltigkeitsskorporatismus vorangetriebenen Klima-Ideologie sowie die staatliche Aneignung von Haus und Grundstück im zum Greifen nahen Kriegsfall.
Fazit
Amüsant ist „Freies Land!“ von der ersten bis zur letzten Seite. Dem Schreibstil sei Dank wird die Lektüre nie trocken. In Zeiten, da immer mehr Autoren dazu übergehen, sich ihre Texte von der KI schreiben zu lassen, ist das Werk eine Perle geistreicher Ausdruckskraft.
Auf 300 Seiten wird dem Leser eine moderne, lehrreiche und zuweilen auch ergreifende Post-Wendezeit-Legende dargeboten, die von Erfolgen und Niederlagen der Ost-West-Verständigung berichtet. Es werden viele Themen angerissen, ohne sich jedoch darin allzu sehr zu vertiefen. Das wäre an und für sich kein Problem, würden die Geschehnisse auf dem 17 Jahre langen Zeitstrahl in Beziehung gesetzt werden. Jedoch rauscht die Erzählung von Jahr zu Jahr, teils mit großen Lücken dazwischen, ohne jedoch Verknüpfungen herzustellen.
Nirgends wird mal festgestellt, welches Menetekel aus dem Jahr 20XX bereits einen Vorgeschmack lieferte auf das, was sich dann ab Jahr 20XX zuspitzte. Daraus hätte man so viel machen können!
Etwa hätte man kontrastieren können, wie eine echte rechte Gefahr aussieht, die sich maßgeblich von dem unterscheidet, wogegen heute hunderttausend Gratismut-Aktivisten auf die Straße gehen. Oder auch den ausufernden Bürokratismus hätte man als Vorboten auf die heutige Übergriffigkeit des Staates in der Vor- oder Rückschau benennen können. Diese Chance wird leider durchgehend vertan.
Und am Ende bleibt die Frage: Für wen ist das Buch geschrieben? Für Prinz-Chaos-Hörer? Für die wenigen potenziellen Nachahmer auf dem überschaubaren Schloss-Immobilienmarkt? Für Städter, die sich nach einer Landflucht sehnen? Für die Hildburghausener? Für FAM-Rezipienten, die sich fragen, was aus Prinz Chaos geworden ist?
Die Frage ist abschließend nicht zu beantworten. Aber wer weiß, wenn sich eines fernen Tages die Verhältnisse hierzulande wieder als freiheitlich bezeichnen lassen können, dann wird vielleicht irgendwo dieses Buch aus einem Regel gezogen und mit Staunen festgestellt, dass sich ein bereits 2025 in Deutschland gedrucktes Buch mit dem Titel schmückt: „Freies Land!“
Hier können Sie das Buch bestellen: „Freies Land! Prinz Chaos, die Thüringer und ein Schloss“