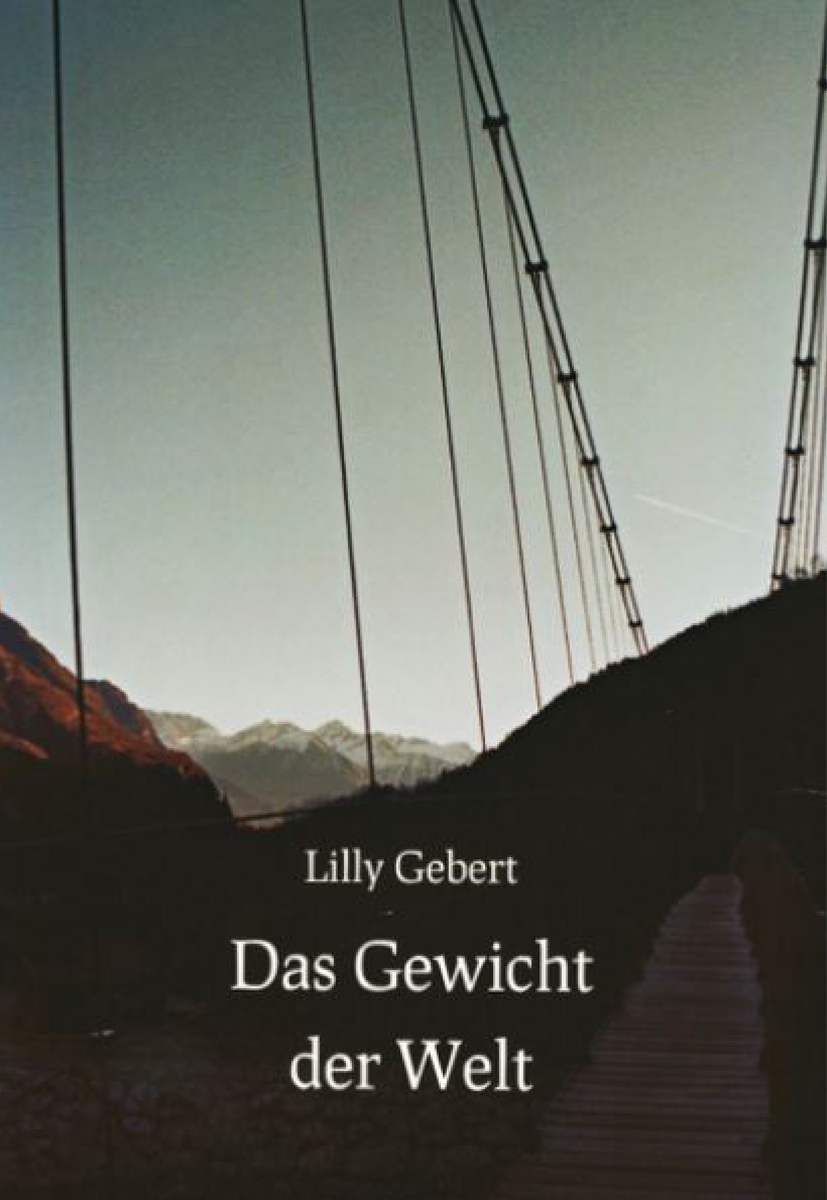Gegen die Welt, für das Leben
Gesund ist derjenige, der noch ein Symptom hat. Denn wer mit schlechten Zuständen nur allzu gut zurechtkommt, wird weder diese noch sich selbst verändern können.
„Es ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine von Grund auf kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein“, sagte der spirituelle Lehrer Jiddu Krishnamurti. Da könnte was dran sein. Denn es ist ein Zeichen von Sensibilität und einem ausgeprägten Gerechtigkeitsgefühl, wenn man angesichts der vielen Fehlentwicklungen der Gesellschaft ein Unbehagen spürt, einen inneren Widerstand, der sich auch in körperlichen Symptomen manifestieren kann. Wem die allgegenwärtige Naturzerstörung Tränen entlockt, dessen Herz lebt noch. Schlimmer wäre es, so abgestumpft zu sein, dass man das Furchtbare gar nicht mehr wahrzunehmen vermag. Man wäre dann ein devoter, im wahrsten Sinne brauchbarer Mitspieler in diesem bösen Spiel. Solange man noch merkt, dass etwas falschläuft, besteht jedoch das Potenzial zur Umkehr. „Solang du frieren kannst, bist du noch nicht erfroren“, sang Udo Jürgens.
1977 wurde Erich Fromm in einem Interview gefragt, wie er zu der „ungeheuren Aussage“ käme, wir lebten „in einer Gesellschaft von notorisch unglücklichen Menschen“. Worauf dieser antwortete:
„Für mich ist sie gar nicht ungeheuerlich, sondern, im Gegenteil, wenn man nur die Augen aufmacht, sieht man das. Das heißt, die meisten Menschen geben vor, für sich selbst auch, dass sie glücklich sind, weil wenn man unglücklich ist, dann ist man — im Englischen würde man sagen ein ‚failure‘ — dann ist man ein ‚Misserfolg‘.
So muss man also die Maske des Zufriedenseins, des Glücklichseins tragen, sonst verliert man den Kredit auf dem Markt, dann ist man kein normaler Mensch, kein tüchtiger Mensch. Aber Sie müssen die Menschen ansehen, da braucht man doch nur zu sehen, da ist eine Maske. Unruhe, Gereiztheit, Ärger, Depressionen, Schlaflosigkeit, Unglücklichsein; was die Franzosen ‚le malaise‘ genannt haben.
Man hat ja schon am Beginn des Jahrhunderts von der ‚malaise du siècle‘ gesprochen. Das, was Freud ‚das Unbehagen in der Kultur‘ genannt hat. Dabei ist es gar nicht das Unbehagen in der Kultur, es ist das Unbehagen in der bürgerlichen Gesellschaft, die den Menschen zum Arbeitstier macht und alles, was wichtig ist, verhindert: Die Fähigkeit zu lieben, für sich und für andere da zu sein, zu denken, nicht ein Instrument zu sein für die Wirtschaft, sondern der Zweck alles wirtschaftlichen Geschehens. Das macht eben die Menschen so wie sie sind, und ich glaube, es ist eine allgemeine Fiktion, die die Menschen miteinander teilen, dass der moderne Mensch glücklich sei. Aber die Beobachtung habe nicht nur ich gemacht. Das können sie bei einer ganzen Reihe von Leuten finden. Man braucht nur selbst die Augen aufzumachen, um sich nicht vom Schein trügen zu lassen.“
Transkribiert habe ich mir dieses Interview im April 2020. Schon damals trafen die Worte Fromms bei mir einen Nerv, stimmten zu sehr mit dem überein, was auch ich in dieser Welt beobachtete. Und woran auch ich litt. Ähnlich wie die Patienten von Fromm, musste auch ich erst das ein oder andere „Symptom“ entwickeln — mehr dazu hier —, um „aufzuwachen“, um zu erkennen, dass ich tief unglücklich bin, dass ich nicht mit meinem Leben zufrieden bin, dass mein Leben keinen Sinn macht und „dass daraus erst die verschiedenen Symptome kommen, nämlich die Versuche, dieses Unglücklichsein zu kompensieren“.
Fromms Schlussfolgerung war an dieser Stelle recht einfach:
„Die Normalsten sind die Kränkesten und die Kranken sind die Gesündesten. (…) Der Mensch, der krank ist, der zeigt, dass bei ihm gewisse menschliche Dinge noch nicht so unterdrückt sind, dass sie in Konflikt kommen mit den Mustern der Kultur und dass sie dadurch, durch diese Friktion, Symptome erzeugen.“
Das Symptom, spricht er weiter, „ist ja wie der Schmerz nur ein Anzeigen, dass etwas nicht stimmt. Glücklich ist der, der ein Symptom hat, wie glücklich der, der einen Schmerz hat, wenn ihm etwas fehlt“. Doch wenngleich jeder wüsste, wie gefährlich es für uns wäre, keine Schmerzen zu empfinden, bestünde die eigentliche Gefahr laut Fromm darin, dass sehr viele Menschen — er nennt sie „die Normalen“ — sich so angepasst hätten, dass sie alles, was ihr Eigenes ist, verlassen haben. Diese seien so entfremdet, so Instrumente, so roboterhaft geworden, dass sie schon gar keinen Konflikt mehr empfänden. Ihr wirkliches Gefühl, ihre Liebe und ihren Hass hätten sie bereits so weit verdrängt, dass ihre Verkümmerung das Bild einer chronischen leichten Schizophrenie bildete.
Deren Ursache glich für Fromm einem offenen Geheimnis: Das, wofür wir leben, unsere Auffassung von Glück und dem guten Leben, sind nicht mehr wir selbst, nicht der Mensch. Stattdessen sei unsere Gesellschaft aufgebaut auf dem Prinzip, dass das einzige Ziel des Lebens darin bestünde, die immer größere Produktion, ferner auch als Konsumption getarnte Kompensation, aufrechtzuerhalten. Es ist das Gefühl einer Entfremdung vom Wahren, dem immer größer werdenden Abstand zwischen uns Menschen und unserer zur Umwelt verkommenden Mitwelt, das schon Michel Houellebecqs „Ausweitung der Kampfzone“ zu durchtränken vermochte:
„Dennoch bleibt ein Stück Freizeit übrig. Was tun? Wie sie nützen? Vielleicht sich den Mitmenschen widmen? Aber im Grunde interessieren die Mitmenschen Sie kaum. Platten hören? Das war einmal eine Lösung, aber im Lauf der Jahre mussten Sie einsehen, dass Musik Sie von Mal zu Mal weniger berührt.“
„(...) jeder sitzt in seiner Ecke und macht, was er will, ohne sich um die anderen zu scheren, es gibt keine Verständigung, es gibt keinen gemeinsamen Plan, es gibt keine Harmonie, Paris ist eine grauenhafte Stadt, die Leute kommen nicht mehr zusammen, sie interessieren sich nicht einmal für ihre Arbeit, alles ist oberflächlich, jeder geht um sechs Uhr nach Hause, ob die Arbeit erledigt ist oder nicht, das alles ist ihnen scheißegal.“
Von Grund- und Alternativlosigkeiten
Wollen wir wirklich so leben? Das frage ich mich seither. Oder sind wir bereits an dem Punkt angekommen, wo wir nicht einmal mehr wissen, wie sich „Leben“ anders gestalten ließe? Ist das wirklich der einzige Entwurf, den wir noch kennen und können? Fragte Fromm einst noch, ob wir nicht eine Industriegesellschaft aufbauen können, „in der das Individuum seine Rolle als aktives, verantwortliches Glied behält, das die Umstände beherrscht, anstatt von ihnen beherrscht zu werden?“ (1), ist meine Antwort auf derartige Überlegungen mittlerweile nur noch: „Wozu?“. Denn ob „sie beherrschend“ oder „von ihnen beherrscht“: Warum möchten wir unser Leben um tote Materie kreisen lassen?
Sind wir tatsächlich bereits selbst so roboterhaft, dass wir uns kein anderes Wirtschaften mehr vorstellen können als das in Dienerschaft?
Was in uns hält an diesen Hierarchien fest — der besagten Unterscheidung zwischen uns und unserer „Umwelt“? Was veranlasst uns dazu, die Welt auf Distanz zu halten? Wovor haben wir Angst? Was könnte uns zu nahe kommen, würden wir es nur lassen? Ist es etwas in der Welt oder doch in unserer inneren Welt?
Zu oft gehe ich des Nachts raus und führe dieses innere Zwiegespräch mit den Sternen. Wie — um Himmels willen — konnte es so weit kommen? Was soll das für eine Lernaufgabe sein? Welcher Architekt hat sich hierfür die Spielregeln ausgedacht? Gibt es überhaupt so etwas wie einen „höheren Plan“? Oder hatte Huxley Recht und diese Welt ist wirklich nur „another planet’s hell“? Ich muss gestehen, dass ich derzeit zum Teil wahrhaft verzweifle. Alles, was ich jahrelang anhand von Analysen und ihren theoretischen Erklärungen versucht habe, von mir fernzuhalten, droht jetzt als Gefühl über mich einzubrechen.
Das Ganze gleicht einer inneren Annäherung an die Erkenntnis, dass manches ganz einfach nicht verstanden werden kann. Ich meine … Erich Fromm, Arno Gruen, Gerald Hüther, Hannah Arendt, Jochen Kirchhoff, Roland Baader, Egon Friedell, Rudolf Steiner, C. G. Jung, Charles Eisenstein, Gunnar Kaiser: Die Liste an Menschen, die den Grund der Dinge bereits in Worte zu fassen vermochten, ist lang. Und doch ist da dieser Abgrund. Dieses Gefühl von Grundlosigkeit. Dass sich manche Dinge zwar benennen und verstehen, nicht aber aus der Welt schaffen lassen. Dass sie — wie auch immer — ihren Weg in diese Welt gefunden haben und in ihr nur eines beabsichtigen: zu bleiben.
Leiden — heute, gestern und übermorgen
Ob die Zeit, in der wir leben, so viel unerträglicher ist als die ihr vorausgegangenen, kann ich nicht beurteilen. Ich lebe jetzt. Und dieses „Jetzt“ fühlt sich nicht so an, als sei es zum Leben gemacht. Der Mensch hungert nach Leben. Gleichzeitig ist diese Welt so entkoppelt, dass ihr niemand mehr zu genügen scheint. So ergibt der Konformismus des einen und die Lebensferne des anderen einen Spagat, den niemand mehr zu überwinden vermag: Während es fast keinem mehr gelingt, das Leben spontan zu erleben, dienen Surrogate in Form von Anreizen und Nervenkitzel wie Alkohol, Sport oder Luxusartikel (2) dem Hinauszögern dessen, „dass der Mensch neurotisch wird, weil er das Maß von Versagung nicht ertragen kann, das ihm die Gesellschaft im Dienste ihrer kulturellen Ideale auferlegt“ (3).
Letzteres zumindest war die bereits 1927 von Sigmund Freud formulierte These, jene Ängste als Ursache für die gegenwärtige Unruhe, das Unglück und die Angststimmung des heutigen Menschen — kurzum, als sein „Unbehagen in der Kultur“ — ausfindig gemacht haben zu wollen. Weil wir ihre Wurzeln vernichtet hätten, bevor wir sie kannten, könnten wir bis heute nicht verstehen, dass Kultur gleichbedeutend ist mit Vervollkommnung. Nicht der Vervollkommnung eines Systems, sondern der Vervollkommnung des Menschen — mit der Natur. Indem wir stattdessen jedoch gelernt hätten, diese zu beherrschen, anstatt in Einklang mit ihr zu leben, hätten wir den eigentlichen Sinn von Kultur verfehlt. Wir hätten uns des Bodens für Frieden und Verbundenheit selbst entledigt und stattdessen die Möglichkeit geschaffen, uns „bis auf den letzten Mann auszurotten“ (4).
Und obwohl sich Menschen immer schon gegenseitig umgebracht haben, erscheint mir dieses Phänomen mit fortschreitender „Zivilisierung“ umso abstrakter, absurder, seelenloser. Wir wissen es „besser“. Der Grund, weswegen wir dem zuwiderhandeln, muss folglich ein anderer sein, denn reines „Wissen“.
Menschen morden, Menschen lügen und betrügen einander. Und das, obwohl jeder von ihnen „wissen“ müsste, dass er den anderen dadurch verletzt, sein Leben verdunkelt — wenn nicht sogar ganz zum Erlöschen bringt. Was also haben wir bis heute nicht geschafft, zu integrieren, dass es uns einander derart zu Monstern werden lässt? Was können wir selbst hier in dieser „freiesten Gesellschaft aller Zeiten“ nicht leben, dass wir es so sehr unterdrücken, bis es nicht mehr anders kann, als in Krieg und Vernichtung zu enden?
„Unter dem Deckmantel der Ich-Stärkung betreiben die Analytiker
in Wirklichkeit eine skandalöse Zerstörung des menschlichen Wesens.“
— Michel Houellebecq, Ausweitung der Kampfzone
Ich muss gestehen, dass es an dieser Stelle für mich keinen „Unterschied“ mehr macht, ob wir die Ursache dieser Gespaltenheit in transgenerationalen Traumen, unserer Entfremdung von der Natur und/oder in einem fehlenden Aufwachsen in Gemeinschaft und einer entsprechend gescheiterten Individuation verorten. Was ich meine, wenn ich schreibe, dass in rationalen Erklärungen Verdrängtes derzeit als Gefühl über mich hereinzubrechen scheint, ist, dass ich merke, wie sich dieses rein rationale Erklären allein in einem Bereich in meinem Körper anlagert. Nämlich im Kopf. Mein Herz wiederum, (…) das versteht nicht. Mein Herz bleibt kalt und zurückgelassen. Bleibt in dem Gefühl, sich dieser Welt nicht zugehörig fühlen zu können. Schlichtweg, weil da zu vieles ist, was nicht seine Sprache spricht.
Der Gott der Dinge
Ein Beispiel von vielen ist in dieser Hinsicht die dafür weltweit am meisten gesprochene Sprache: Bürokratie. Diese schlägt mir stets derart auf den Magen, dass sie mich über Tage kreativ zu blockieren weiß. Nicht weil sie mich überfordert, sondern weil ihr — für mein Empfinden — vom Wesen her etwas Entfremdetes anhaftet. Ich empfinde sie dem Leben als nicht zugehörig und würde daher am liebsten gar nichts mit ihr zu tun haben, „muss“ dies aber.
Womit wir erneut bei dieser Unterscheidung, dem Perspektivenwechsel wären, die Dinge nicht aus einer Verstandesebene heraus zu betrachten, sondern mit dem Herzen. Mit meinem Verstand schließlich muss ein bürokratischer Aufwand zwar immer noch keinen „Sinn“ ergeben, ich kann ihn jedoch insofern nachvollziehen, als dass ich weiß, welche Überlegungen dahinterstehen und inwieweit sich dieser Akt in einen Berg von Akten einsortieren lässt. Blicke ich jedoch mit dem Herzen auf diese Papiere, diese Versuche, „Leben“ in Paragrafen auszudrücken und den Menschen in seiner Existenz insofern ins Wanken zu bringen, als dass dieser sich permanent unter Generalverdacht zu fühlen habe, beschleicht mich ein großes Unverständnis.
Da ist dieses Unbehagen darüber, das Menschsein an Bedingungen geknüpft zu wissen, die als solche nicht menschlich sind. Sei es das „Nacktmachen“ vor dem Staat, die Erwartungshaltungen und ausbleibenden Anerkennungen innerhalb der Gesellschaft oder das sich bis in engste Beziehungen schleichende beweisen Müssen der eigenen Liebenswürdigkeit. In diesen Zeiten Mensch zu bleiben, erscheint mir als größte Menschheitsaufgabe überhaupt. Nicht anheim zu fallen den Verlockungen und Versuchungen, die wir uns in der Hoffnung geschaffen haben, genau ihren Ruf nicht mehr zu spüren und folglich auch nicht erfüllen zu müssen.
Ich glaube, damit haben wir weit gefehlt. Denn anders als Huxley glaube ich nicht, dass diese Erde nur die Hölle eines anderen Planeten ist. Vielmehr glaube ich, dass wir den Materialismus aus dem Grund so tief in diese Welt und unser Leben haben dringen lassen, um ihn als die Autorität zu installieren, die wir als einzige nicht als solche wahrnehmen.
Nach all’ den Faschismen und Glaubensherrschaften ist der Materialismus die einzige Möglichkeit, den Glauben an eine „freie Welt“ aufrechtzuerhalten, ohne den eigenen Gehorsam erkennen, geschweige denn aufgeben zu müssen.
Der Materialismus — mitsamt seiner Perversionen von Neoliberalismus bis zur technologischen Singularität — ist nichts weiter als der letzte Versuch des Menschen, seiner eigenen Individuation zu entkommen.
„Die Tragödie besteht nicht darin, allein zu sein, sondern nicht allein sein zu können. Manchmal würde ich alles hingeben, um durch nichts mehr mit der Welt der Menschen verbunden zu sein. Aber ich bin ein Teil dieser Welt, und so ist es am tapfersten, sie und mit ihr die Tragödie zu akzeptieren.“ — Albert Camus, Tagebuch März 1951 — Dezember 1959
Bis dahin ist alles, was wir anhand jener Surrogate versuchen darzustellen, bloßer Individualismus: der krampfhafte Versuch, anhand von Konsum sich äußerlich von dem zu befreien, von dem man sich innerlich nicht lösen kann. Und im Grunde schließt sich hiermit der Kreis: im fehlenden Glauben. Wir brauchen die Autorität, weil wir nicht an uns selber glauben können. Weil wir über keinen inneren Gehorsam , kein humanistisches Gewissen (Fromm) verfügen. Egal ob auf ideologischen Dogmen oder Sachzwängen beruhend: Wir brauchen den Totalitarismus , weil wir nicht wissen, wie sich ein Leben unter „eigenem Befehl“ gestalten ließe.
So aber wurzelt unser Leben in dem immerwährenden Zweifel an die Verwirklichung unserer selbst. Eben, so meine These, weil wir dieses „Selbst“ nicht mehr losgelöst von Materie betrachten können. Da ist keine Seele mehr, kein höheres Selbst, an das wir glauben und von dem wir glauben, seinen Grund dafür — als die, die wiederum wir sind — hier auf Erden reinkarniert zu sein, verstehen und erfüllen zu wollen.
Uns fehlt es an Zugang zur Welt, der nicht primär verstandesbasiert ist. Der allgemein nicht von dieser Welt als solcher ausgeht. Solange uns dies jedoch nicht gelingt und wir es nicht schaffen, uns die Möglichkeit einzugestehen, nicht ausschließlich in dieser Dimension zu existieren, sondern immer auch in ätherischen und astralen, in welchen obendrein nicht nur dieses Leben innewohnt, sondern viele viele vor wie nach uns, bleiben wir angewiesen auf den letzten Gott, der uns noch geblieben ist: den Gott der Dinge. Insofern seine Gefolgschaft jedoch nicht auf Glauben, sondern auf Zweifel basiert, wird auch seine Weltanschauung auf ewig relativistisch und damit nihilistisch bleiben (5). Weil er nicht dem Leben dient, bleiben diesem auch die ihm Folgenden auf ewig fremd. Sie fühlen sich sinnentleert und gottverlassen.
Sind andere „in diesen Schlachten in der Überzeugung gestorben, es sei besser, im Kampf gegen die Unterdrückung zu sterben, als ohne Freiheit zu leben“ und sahen in einem solchen Tod „die höchste Bestätigung ihrer Individualität“ (6), finden sich die Nihilisten mit Fromms „Doppelgesicht der Freiheit“ konfrontiert:
„Der Einzelne wird von wirtschaftlichen und politischen Fesseln frei. Er gewinnt auch etwas an positiver Freiheit durch die aktive, unabhängige Rolle, die er im neuen System spielen muß. Aber gleichzeitig wird er auch von all jenen Bindungen frei, die ihm zuvor Sicherheit und ein Gefühl der Zugehörigkeit gaben. Das Leben läuft nicht mehr in einer in sich geschlossenen Welt ab, deren Mittelpunkt der Mensch war, die Welt ist grenzenlos und zugleich bedrohlich geworden. Dadurch, daß er seinen festen Platz in einer in sich geschlossenen Welt verliert, geht dem Menschen auch die Antwort auf die Frage nach dem Sinn seines Lebens verloren. Er fühlt sich von mächtigen, überpersönlichen Kräften, dem Kapital und dem Markt, bedroht. Die Beziehung zu seinen Mitmenschen, von denen jeder ein potentieller Konkurrent ist, wird feindlich und entfremdet. Er ist frei — das heißt, er ist allein, isoliert, bedroht von allen Seiten. Da er weder den Reichtum noch die Macht besitzt, über welche die Renaissance-Kapitalisten verfügten, und da er überdies das Gefühl des Einsseins mit seinen Mitmenschen und dem Universum verloren hat, überwältigt ihn ein Gefühl persönlicher Nichtigkeit und Hilflosigkeit. Er hat das Paradies auf immer verloren. Der Einzelne steht allein der Welt gegenüber — ein Fremder, hineingeworfen in eine grenzenlose, bedrohliche Welt. Die neue Freiheit musste in ihm ein tiefes Gefühl der Unsicherheit und Ohnmacht, des Zweifels, der Verlassenheit und Angst wecken. Wenn der Mensch sich in der Welt behaupten sollte, musste er wenigstens teilweise von diesen Gefühlen erleichtert werden“ (7).
Glücklich ist, wer noch ein Symptom hat
Womit wir zurück am Anfang dieses Textes wären. Als auch der erneut aufkommenden Frage danach, was „Heilung“ in Zeiten des Unheils und Unheilseins überhaupt noch zu bedeuten hat. Besteht ihr Weg darin, die Disruption nicht mehr zu spüren, oder gleicht ihre Antwort mehr jener, die auch Houellebecq einem seiner Protagonisten als Antwort auf dessen Frage „Bin ich geheilt?“ zu verstehen gab? — „Nein, Sie sind jemand, der anders ist und den anderen gleichen möchte. Das ist meiner Meinung nach eine schwere Krankheit.“
Vermutlich gilt es, unser Bild von Krankheit zuerst zu verändern, wollen wir ihr langfristig nicht auch noch anheimfallen.
Seien es Autoimmunerkrankungen oder Krebs, als auch psychische Erkrankungen wie Süchte oder Borderline: Anstatt Diagnosen zu internalisieren, ist es vielleicht an der Zeit, in diesem Leben erstmals richtig zu inkarnieren — zu realisieren, dass wir nicht grundlos hier auf Erden sind und uns stattdessen unserer auf ihr zu bewältigenden Aufgabe bewusst zu werden, ihr ins Auge zu blicken, anstatt diese fortwährend zu verdecken.
Mensch bleiben — oder überhaupt erst werden — können wir erst, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass in ihm unsere eigentlichste Aufgabe besteht. Dass jeder Tag, jede Stunde und Sekunde darauf beruht, uns zu lehren, in unserer Menschlichkeit zu ruhen. Bei uns zu bleiben und nicht der ihr zuwiderlaufenden Versuchungen zu verfallen. Tiefgehende Beziehungen zu führen, anstatt auch Menschen wie Objekte zu behandeln. Tiere zu streicheln und nicht zu essen. Die Natur zu ehren, anstatt sie zu missbrauchen. Kurzum: Dem Leben einen Sinn zu verleihen, anstatt der Sinnlosigkeit dieser Welt zu verfallen. Eben das Gegengewicht zu dieser „Berührungslosen Gesellschaft“ zu bilden, wie es Elisabeth von Thadden bereits so treffend formulierte:
„Nur wer berührbar ist, verletzlich, schwach, unperfekt, der ist nahbar. Nur wer nahbar ist, wer liebt, wer mit der Angst und der Lust, der Scham und der Wut ringt, der existiert. Der ist noch lebendig und kämpft dagegen, nach dem Marktwert zu gehen.“
Durch nichts riskieren wir unsere Gesundheit — und damit unser Leben — so sehr, wie wenn wir vergessen, wer wir sind. Denn wenn wir aufhören, so zu leben, wie es für uns einen Sinn ergibt, ergibt unser ganzes Leben keinen Sinn mehr. In allen Beziehungen, die wir von dem Moment an führen werden, werden wir aufhören, in-Beziehung zu sein. Eben weil es im Kern nicht mehr wir sind, die diese Beziehungen führen und folglich auch nicht von den ihnen innewohnenden gesundheitlichen „Vorteilen“ wie Nähe und Verbundenheit zehren können. Denn auch diese Beziehungen beruhen auf Zweifeln anstelle von Vertrauen. Zweifel an uns, am Leben, an unserer eigenen Liebenswürdigkeit.
„Es ist nicht wahr, dass das Herz sich abnutzt
— sondern der Körper, der dann zur Täuschung wird.“
— Albert Camus, Tagebuch März 1951 — Dezember 1959
Diese Liebenswürdigkeit den eigenen „Symptomen“ zu entnehmen und diese im Umkehrschluss in erste zu verwandeln — darin liegt vermutlich der Kern dessen, was ich mit diesem Text sagen wollte. Hören wir auf, uns für unsere Weltfremdheit zu schämen und nehmen wir sie lieber als Geschenk. Denn wo wären wir jetzt ohne sie? Mit wem säßen wir zusammen? Über welche Dinge würden wir reden? Könnten wir mit uns alleine sein? Sähen wir die Welt, so wie sie ist, und könnten uns ihr gegenüber entsprechend authentisch positionieren? Oder müssten wir uns am Ende unseres Lebens eingestehen, dieses in Illusionen verbracht zu haben?
Wie nahe kommen wir an das, was diese Welt im Innersten zusammenhält, ohne uns in ihr zu verlieren? An dieser Stelle kann ich nur dazu raten, weiterhin suchend zu bleibend, eben nicht die Augen vor dem zu verschließen, was Leben sein will. Haben wir erst einmal akzeptiert, dass die Dinge so sind, wie sie sind, haben wir ohnehin verloren.
Darum besteht zumindest für mich der Weg, dieser entkoppelten Welt nicht anheimzufallen, darin, mich selbst von ihr zu entkoppeln. Mich jeder Zwangsläufigkeit ihres inhärenten Müssens und Sollens dadurch zu entziehen, mich der Welt zu entziehen. Ich für mein Gefühl nämlich glaube, dass jedes Gefühl gelebt werden möchte. So auch das Gefühl der Weltfremdheit. Und wer weiß schon, wer oder was uns in die Arme nimmt, wenn wir uns von allen anderen verabschiedet haben? Die Welt dazwischen? Gott? Oder wir uns selbst? Welche Welt geht auf, wenn die andere sich schließt?
Nehmen wir unsere Weltfremdheit nicht länger als Ausdruck eines Nichtrichtigseins. Ganz im Gegenteil: Nehmen wir sie als Ausdruck dessen, dass uns noch das Gefühl dafür innewohnt, was in dieser Welt alles nicht richtig ist.
Auf diese Weise können wir nämlich auch mit Stolz das folgende Zitat Ivan Illichs bejahen:
„Aber ich will nicht in diese Welt gehören. Ich will mich in ihr als Fremder, als Wanderer, als Außenseiter, als Besucher, als Gefangener fühlen. Ja, ich spreche von einem Vor-Urteil, also von einer Haltung, nein, nicht einer Haltung, meiner Haltung. Einem Grund, auf dem ich stehe, auf dem ich bestehe…“
Redaktionelle Anmerkung: Dieser Beitrag erschien zuerst unter dem Titel „Gegen die Welt, für das Leben“ bei Treffpunkt im Unendlichen , dem Substack von Lilly Gebert.
Hier können Sie das Buch bestellen: Tredition