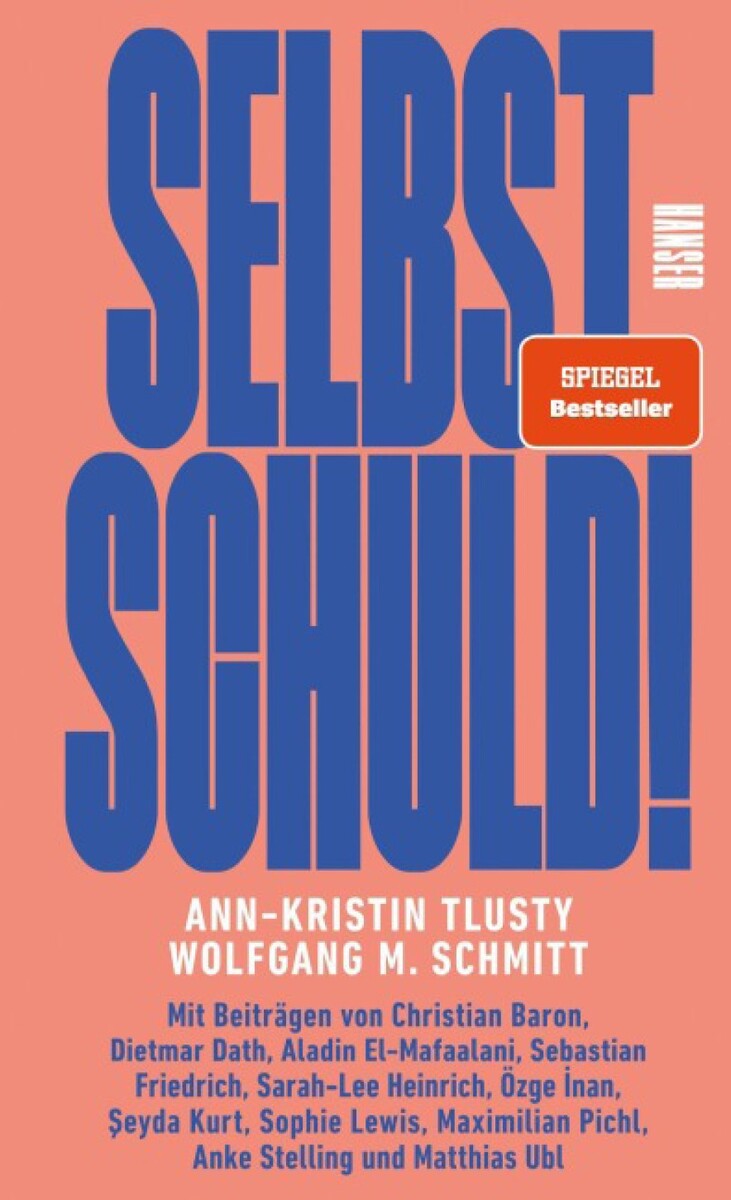Der Eigenschuld-Mythos
Die von Ann-Kristin Tlusty und Wolfgang M. Schmitt herausgegebene Anthologie „Selbst schuld!“ liefert brillante Analysen zur neoliberalen Mär der Eigenverantwortung und zeigt die begrenzten Denkhorizonte heutiger Intellektueller auf.
Sind wir selbst schuld, wenn wir in Armut leben, weil wir uns nicht mehr Mühe gegeben haben? Selbst schuld, wenn wir so viel Zeit auf Instagram verplempern? Selbst schuld am sogenannten menschengemachten Klimawandel? Tragen wir Schuld an dem Corona-Tod der Oma, weil wir uns zuvor nicht die Hände gewaschen haben? Haben wir gar selbst schuld daran, wenn wir misshandelt werden? Selbst in Gesellschafts- und Lebensbereichen, in denen als Antwort auf diese Frage ein unmittelbares und glasklares „Nein“ zu erwarten wäre, ist vielfach eine Selbstbeschuldigung zu beobachten. Grund genug, sich umfassend und multiperspektivisch mit diesem Phänomen zu befassen. Das haben 13 Autorinnen und Autoren, inklusive der Herausgeber Ann-Kristin Tlusty und Wolfgang M. Schmitt, in der Anthologie „Selbst schuld!“ getan. Auf rund 250 Seiten wird in den verschiedenartigsten Bereichen der Frage nachgegangen, ob das Individuum „selbst schuld“ am eigenen und kollektiven Unglück habe — allerdings nur innerhalb bestimmter Denkgrenzen. Denn so gelungen die Analysen auf spezifischen Themenfeldern auch sind, so groß sind die toten Betrachtungswinkel, wenn es um die großen Agenden unserer Zeit geht. Die diesbezüglich herrschenden Axiome werden von den Autoren nicht angetastet. Auf der Inhaltsebene ist der Sammelband über weite Strecken hinweg aufschlussreich und auf einer Metaebene ein bemerkenswerter Indikator für die Grenzen des Sagbaren im Jahr 2024. Eine Rezension.
„Der schlaueste Weg, Menschen passiv und gehorsam zu halten, ist, das Spektrum an akzeptabler Meinung streng zu beschränken, aber eine sehr lebhafte Debatte innerhalb dieses Spektrums zu ermöglichen — sogar die kritischeren und die Ansichten der Dissidenten zu fördern. Das gibt den Menschen ein Gefühl, dass es ein freies Denken gibt, während die Voraussetzungen des Systems durch die Grenzen der Diskussion gestärkt werden.“
Dieser Sammelband zeigt dem Leser eindrücklich, was Noam Chomsky mit dem oben angeführten Zitat gemeint hat. Der Buchrücken verspricht „ein Manifest kritischen Denkens für die Gegenwart“. Und dieses Versprechen wird auch eingelöst. Die Anthologie ist satt gefüllt mit Texten, die Zeugnis kritischen Denkens sind, wie es unserer Gegenwart eigentümlich ist. Brillant fokussiert auf Einzelheiten, aber blind für das Big Picture.
Es ist die „Selbst schuld“-Frage, die die insgesamt 13 Texte dieses Sammelwerkes zum Gegenstand haben. Vereinzelt befinden sich darunter Texte, bei denen eine Einbettung ins Big Picture gar nicht notwendig wäre, es vielleicht sogar den spezifischen Betrachtungsgegenstand des Textes verwässern würde, wenn man ihn aus einer zu hohen Vogelperspektive betrachtete. Gerade die persönliche Note, die Selbstbetroffenheit, die bei vielen Texten enthalten ist, gibt ihnen die Würze.
Da gibt es aber zum anderen auch jene Textbeiträge, die für sich selbst beanspruchen, einen Panoramablick einzunehmen, die jedoch diesem vorgeblichen Weitblick nicht im Ansatz gerecht werden. Bei den Texten kommen die großen Narrative unserer Zeit zum Tragen, die über das gesamte Werk hinweg unangetastet bleiben. Die Rede ist hier vom Narrativ des menschengemachten Klimawandels und natürlich Corona. Beide Themen böten sich eigentlich auf einem Präsentierteller samt Filetiermesser an, um sich an den grundfalschen Schuld-Glaubenssätzen abzuarbeiten.
Zunächst sollen hier in ein paar Sätzen über den Stil und Format als auch über die Autorenbesetzung gesprochen werden, ehe im Nachgang die unterschiedlichen Arten von Texten genauer unter die Lupe kommen.
Stil, Format und Autoren
Zwischen den Buchdeckeln finden sich insgesamt 13 Texte von je fünfzehn bis zwanzig Seiten. Jeder Text ist vom Umfang her gut geeignet, um während einer kurzen Fahrt mit Bus oder Bahn gelesen zu werden. Die thematische Anordnung ist abwechslungsreich gestaltet.
Insofern wäre ein flüssiger Lesefluss gegeben, hätte man nicht größtenteils gegendert. Zwar bleibt dem Leser das Sternchen-Massaker erspart, da mit Doppelpunkten die „alle Geschlechter inkludierende“ Schreibweise verwendet wird. Dennoch stoppt das mitunter den Lesefluss.
Auf einer Metabene entbehrt dies nicht einer gewissen Ironie, erwächst das Gendern von Texten doch entweder einer tiefen, ideologischen Überzeugung oder aber aus einem durch Schuldgefühl entstandenen Pflichtgefühl heraus, gerade bei den männlichen Autoren: das Schuldgefühl nämlich, früher immer eine „patriarchale“ Schreibweise verwendet zu haben, das generische Maskulinum, mit dem man(n) sämtliche nicht männlichen Geschlechter unberücksichtigt gelassen habe.
Dass diese Art von Sprachverhunzung rein ideologischer Natur ist und keinerlei Verbesserung in Sachen sozialer oder geschlechtlicher Gerechtigkeit gebiert, überdies mit der deutschen Grammatik nicht vereinbar ist, wurde in den letzten Jahren schon an vielerlei anderer Stelle ausführlich dargelegt. Es zeigen sich also schon auf der Formebene des Buches tote Winkel in der Ideologiekritik der Autoren.
Und damit kommen wir auch schon genau darauf zu sprechen. Ich wurde durch den von mir persönlich geschätzten Mitherausgeber Wolfgang M. Schmitt auf die Anthologie aufmerksam, war neugierig und legte mir das Buch zu, ohne vorab auf die Liste der Autoren zu sehen. Erst nach Eintreffen des Werks studierte ich die Autorenbeschreibungen und stellte dann fest, dass diese allesamt mehr oder weniger dem Dunstkreis des Mainstreams entstammen: NDR, ZDF, FAZ, Zeit online et cetera. Von dem Zeitpunkt an wusste ich, dass die mich in diesem Buch erwartende Ideologiekritik bestimmten Limitationen unterliegen würde. Die Zugehörigkeit der Autoren zum politmedialen Mainstream erlaubt es eben nicht, gewisse gedankliche Sperrgebiete zu betreten, siehe abermals das oben angeführte Chomsky-Zitat.
Insofern war ich ganz froh, mich nicht im Vorfeld über die Autoren — oder, wie sie sich selbst nennen, die Autor:innen — informiert zu haben. Andernfalls hätte ich wohl durch Voreingenommenheit nie zu dem Buch gegriffen. Ich verstand die vor mir liegende Lektüre als experimentelle Herausforderung, mich auf die Sichtweisen von Denkern einzulassen, die ich sonst in einer Schublade mit Richard David Precht und Gert Scobel liegen gelassen hätte.
Im Zusammenhang mit der Autorenschaft ist noch das junge Durchschnittsalter zu erwähnen. 10 der 13 Autoren sind ab 1985 geboren und damit unter vierzig. Als Leser bekommen wir in diesem Sammelwerk vor Augen geführt, wie es um Deutschlands Nachwuchsintellektuelle bestellt ist.
Lebensnahe statt rein theoretische Analysen
Bei all der bereits genannten Kritik muss betont werden, dass die Anthologie über wahre Schätze verfügt. Das sind gerade die Texte, die sich auf ein bestimmtes Schuld(gefühl)-Phänomen fokussieren und es im Einzelnen betrachten. Sobald die Phänomene in einen größeren Kontext, namentlich den der großen Agenden, eingebettet werden, kommt es zu den bereits beschriebenen Schwächen. Auf alle Beiträge einzugehen, würde den Rahmen dieser Rezension sprengen. Daher wird im Nachfolgenden nur auf vereinzelte und nicht auf alle Buchbeiträge eingegangen.
Der erste Beitrag dieses Sammelbandes ist eine sehr bewegende, biografische Erzählung von Sarah-Lee Heinrich. Die 2001 geborene und damit zugleich jüngste Autorin des Bands schildert darin lebhaft ihren Weg heraus aus prekären Lebensverhältnissen. Anhand vieler, bedrückender Beispiele beschreibt sie, wie sie von der Gesellschaft mal subtil, mal ganz direkt vermittelt bekam, sie und ihre alleinerziehende Mutter wären in Bezug auf ihre Situation vor allem eines: selbst schuld! Hätten sie sich mehr angestrengt, so wären sie nicht in dieser Lage, so die kühle, kaltschnäuzige Logik der meritokratischen Leistungsideologie. Heinrich war bis September 2024 im Bündnis 90 die Grünen und bewegt sich auch nach wie vor in diesem weltanschaulichen Gravitationsfeld.
Wie oben bereits erwähnt, habe ich den Sammelband im Blindflug, das heißt vorurteilsfrei mit einem gewissen Vertrauensvorschuss gekauft. Andernfalls hätte ich wohl nie den Textbeitrag einer — ehemals — grünen Politikerin gelesen. Entgangen wäre mir also, dass es wohl selbst innerhalb der grünen Jugend auch Menschen gibt/gab, die nicht wohlstandsverwahrlost sind, sondern die Härte eines Lebens am Existenzminimum am eigenen Leib erfahren haben. Solche Menschen sind dann folglich weniger anfällig dafür, realitätsferne Forderungen aus dem grünen Windrad-Wunderland ökonomisch schwachen Mitmenschen aufzubürden.
Mitherausgeberin Ann-Kristin Tlusty brilliert mit einer grandiosen Analyse der Schuldgefühle, welche eine Leistungsgesellschaft in den Individuen hervorruft, die auf ihr natürliches Recht auf Faulheit pochen. Sie schlägt dabei einen historischen Bogen und zeigt, wie die fremdbestimmte Taktung des Tagesablaufs erst mit der Industrialisierung der Masse aufgezwungen wurde. Zuvor war Derartiges den Menschen fremd, deren Tagesgestaltung mit der damit verbundenen Arbeitsaufteilung sich nach natürlichen Rhythmen richtete.
Mittlerweile, so zeigt Tlusty auf, hat der Mensch in den Industrienationen die widernatürliche Aufteilung seiner Lebenszeit in „Freizeit“ und „Arbeitszeit“ nicht nur derart verinnerlicht, dass er es gar nicht mehr anders kennt, er kann sich auch nicht mehr vorstellen, dass es mal anders wahr.
Darüber hinaus kippt die sogenannte Work-Life-Balance in eine Work-Life-Disbalance, denn die Logik der Arbeitszeit hält immer weiter in der Freizeit Einzug. Der neoliberal als Ich-AG geprägte Mensch muss schließlich auch seine (un)freie Zeit nutzbringend gestalten und an seiner Persönlichkeitsentwicklung wie auch der Pflege seines Images auf Social Media arbeiten. Die Faulheit als „selbstbesimmte Zwecklosigkeit“, wie Tlusty den Philosophen Josef Pieper zitiert, ist in dieser Leistungslogik gar nicht mehr möglich. Stattdessen gibt sich der Mensch einem „stresslaxing“ hing. Gemeint ist damit der Versuch, zu relaxen, was aufgrund des Stresses nicht mehr möglich ist, der durch die sich aus dem Leistungsimperativ ergebenden Schuldgefühle hervorgerufen wird. Tlustys Text ist kein Nachruf auf das menschliche Recht auf Faulheit, sondern ein Plädoyer dafür, sich daran wieder zu erinnern und es zurückzuerobern.
Sie räumt hierbei nicht nur mit den politmedial geschürten Faultier-Feindbildern („soziale Hängematte“, „faule Griechen“) auf, sondern skizziert zugleich die gegenwärtigen Perversionen dieses Zeitverwertungsregimes. So vermögen es ökonomisch besser gestellte Menschen, sich Faulheit zu erkaufen, indem sie die lästigen Alltagsarbeiten an prekär beschäftigte Menschen abtreten. Die Inanspruchnahme von Lieferdiensten nimmt Tlusty hierbei als mustergültiges Beispiel. Alles in allem ist dieser Text bestens geeignet, um ihn so manch meritokratischen Einpeitschern in Gestalt von Motivationscoaches um die Ohren zu hauen.
Sehr unangenehm wird es in dem Beitrag von Özge İnan. Wohl kaum jemand empfindet sich als „selbst schuld“ daran, wenn er auf der Straße ausgeraubt, angepöbelt oder von jemandem die Vorfahrt beschnitten bekommt. Ganz anders verhält es sich jedoch bei sexualisierter Gewalt: Hier empfinden sich, wie İnan aufzeigt, die allermeisten Opfer, mal mehr, mal weniger, als „selbst schuld“. Selbst schuld deswegen, weil die Opfer sich selbst vorwerfen, die Grenze (non)verbal nicht klar genug kommuniziert, sich zu aufreizend gekleidet zu haben et cetera. Inan erklärt das Phänomen mit Verweis auf psychologische Untersuchungen, wonach der Selbstvorwurf-Mechanismus eine Bewältigungsstrategie darstelle und die Opfer sich dadurch das Gefühl von Restselbstwirksamkeit in Form von möglichen und zukünftigen Verhaltensänderungen bewahren.
Dass (Selbst-)Viktimisierung ein strukturelles Problem ist, welches der juristischen Überführung des Täters nicht selten im Wege steht, zeigt die Juristin mit einem Exkurs in das „Gruselkabinett der (deutschen) Rechtsgeschichte“.
Dabei zitiert sie aus teils abstrusen, teils unglaublichen Gerichtsurteilen, die eine gedruckte Form von Täterschutz und Opferverhöhnung in einem darstellen. Mit der halsbrecherischsten Wortakrobatik im Juristen-Deutsch („Verführungswiderstand durch seine gewaltsame und unziemliche Verhaltensweise überwunden“) wurden bis vor Kurzem in Gerichtssälen sexuelle Übergriffe wohlwollend in „Missverständnisse“ umgedeutet und dem Opfer zur Last gelegt, sein Widerstreben nicht deutlich genug artikuliert und gestikuliert zu haben. Dankenswerterweise behandelt İnan diesen sensiblen Schuld-Themenkomplex äußerst differenziert und geht mit der Täterschutz-Justiz genauso hart ins Gericht wie mit der Selbstjustiz auf Social Media im Kontext von #meToo.
Scharf differenziert sie hier zwischen dem damals mehr als überfälligen Anstoßen und Aufdecken der strukturellen Missbrauchsdynamik einerseits und andererseits zwischen dem daraus geborenen „Social-Media-Gerichtshof“ mit all seinen missbräuchlichen Potenzialen, wenn es darum geht, missliebige Menschen unschuldig an den sozialen Pranger zu stellen. Mit Verständnis für die emotionalen Entladungen einerseits betont sie dennoch weitsichtig die Gefahren, wenn vermeintliche Täter ohne Gerichtsverfahren pauschal vorverurteilt und schuldig gesprochen, somit nachhaltig gebrandmarkt werden, obwohl sie genau das nicht sind: schuldig.
Holzwege und Nebenkriegsschauplätze
Welches Geschehen war mit mehr Schuld aufgeladen als das Corona-Thema? Nicht einmal das Themenfeld „Klima“ war und ist so mit Schuld behaftet wie das Virus-Narrativ. Beim Klima lagen die Folgen der den Menschen eingetrichterten Schuld in einer mal ferneren, mal näheren Zukunft. Das für den Klimawandel ursächliche Verhalten wurde, gerade von den jungen Klimaaktivisten und Friday-for-Future-Mitläufern, der älteren Generation angelastet — ganz so, als hätte man sich an deren Stelle nicht genauso verhalten. Dazu später mehr.
Bei Corona hatte die Schuld hingegen einen unmittelbaren Charakter. Wer sich nicht an die Regeln hielt, wer es wagte, urnatürlichen, menschlichen Regungen wie Umarmungen nachzugeben, der galt als direkt schuldig an dem Tod von unzähligen Menschen.
Was könnte man hier alles aufarbeiten? Das im April 2020 geleakte Panikpapier des Bundesministeriums des Innern (BMI), in welchem Strategien ausgearbeitet waren, wie Kindern tiefgreifende, seelisch vernarbende Schuldgefühle eingetrichtert werden könnten, indem man sie glauben lässt, ihre Unachtsamkeit habe den Tod der Großeltern herbeigeführt. Oder denken wir an das Gaslighting und die Täter-Opfer-Umkehr durch den Bundesärztekammer-Präsidenten Ulrich Montgomery, der von der „Tyrannei der Ungeimpften“ sprach, während es ja genau diese Bevölkerungsgruppe war, die über ein Jahr lang von Politik, Medien und Mitmenschen tyrannisiert wurde.
Oder aber denken wir an den Familienrichter Christian Dettmar, der nun schuldig gesprochen wurde, weil er in der Zeit der Fake-Pandemie seine Aufgaben und Pflichten ernst nahm und sich darum bemühte, Kinder von den nicht nur psychosozial schädlichen Giftmasken zu befreien. Ganz allgemein wären hier all das unzählige Unrecht und die Demütigungen und Diffamierungen aufzulisten, welche allen noch so besonnenen Maßnahmenkritikern widerfahren sind.
Es gibt hier thematisch mehr tief hängende Früchte als Autoren, die sie pflücken können. Doch was wird im vorliegenden Buch daraus gemacht? Nichts, wie der Rechts- und Politikwissenschaftler Maximilian Pichl in seinem Textbeitrag demonstriert. Denn an welchem Phänomen arbeitet er sich ab? An den Ausschreitungen der sogenannten Party- und Eventszene im Lockdown-Sommer 2020 und der Gnadenlosigkeit, mit der die baden-württembergische Politik und die ihr angeschlossenen Strafverfolgungsbehörden solches ahndeten, ohne dabei die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, die die entsprechende Frustration erst ausgelöst haben. Genau diese Rahmenbedingungen greift Pichl auf; er benennt die frustrierende, aggressionsfördernde Wirkungsweise der massiven Freiheitseinschränkungen auch — aber nicht nur — für Jugendliche.
Statt diese allerdings anzukreiden, sie als das zu benennen, was sie sind, nämlich illegitim und aufs Gröbste grundgesetzwidrig, behauptet er, der Staat sei „verfassungsrechtlich dazu angehalten, Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu ergreifen“. Er geht von einem staatlichen Gesundheitsschutz als Supergrundrecht aus, dessen verfassungsrechtliches — nicht existentes — Sein kritische Juristen wie Alexander Christ (2022) und andere hinlänglich widerlegt haben. Im Grunde genommen würde hierfür schon ein oberflächlicher Blick in das Grundgesetz genügen, welches man seinerzeit teilweise nicht einmal in der Öffentlichkeit mitführen oder alleine (!) auf einer Parkbank an der frischen Luft lesen durfte.
Auf einem Trümmerfeld der Verfassungsbrüche arbeitet sich der Rechtswissenschaftler an einem für sich nicht unwichtigen, aber im Gesamtbild doch arg vernachlässigbaren Nebenkriegsschauplatz ab.
Zwar prangert Pichl die Doppelstandards an, hinterfragt aber nicht die Maßeinheit, auf der diese zweierlei Maßstäbe beruhen.
Wer es in dem Band ebenfalls in dieser Angelegenheit dabei belässt, Doppelstandards anzuprangern, statt die Maßeinheit infrage zu stellen, ist der Mitherausgeber Wolfgang M. Schmitt. Der sonst mit geschärften Auge nahezu jede Ideologie durchleuchtende Filmanalyst hat leider schon in der jüngsten Vergangenheit bewiesen, dass er bei Corona gemäß seiner Andrei-Tarkowski-Catchphrase „nur schaut, aber nicht sieht“. Was unter dem Kampfbegriff „Verschwörungstheorie“ subsumiert wird, ist für Schmitt nur eine Ideologie unter vielen, deren Annahmen er a priori als „falsch“ erachtet und allenfalls als dazu geeignet hält, widerlegt zu werden.
Schmitt behandelt in seinem Text über den Nationalstaat nicht explizit das Thema Corona, er führt es vielmehr nur als Beispiel für die Doppelstandards des Staates an. Im Kern dreht sich sein Essay um das Pflichtgefühl des Menschen gegenüber dem Staat und das dadurch evozierte Schuldgefühl, wenn dieser angenommenen Pflicht nicht in gebührender Weise nachgekommen wird.
Im Bezug auf Corona hätte man aus dieser Fragestellung so viel machen können. Man denke nur an die vielen Diskurse, die einseitig darüber geführt wurden, nicht inwieweit, sondern warum es die Pflicht des Bürgers sei, sich zu maskieren, Abstand zu halten, Menschen einsam in Krankenhäuser und Altenheime verrecken zu lassen und sich letztlich unumstritten hochgiftige Pharmasubstanzen in den Körper zu jagen. All das hätte aufgegriffen werden können — nur wird es das nicht.
Dennoch ist im Großen und Ganzen sein Text über weite Strecken mehr als gelungen, was damit zusammenhängt, dass er auf dem antimilitaristischen Auge so weitsichtig ist, wie er auf dem Corona-Auge blind ist. Dass Corona auch Teil einer — wenngleich hybriden — Kriegführung ist („Krieg gegen das Virus“ — Emmanuel Macron), drang bis heute nicht zu Schmitt durch. So arbeitet er sich an dem vielfach beschworenen, aber letztlich imaginär bleibenden „Wir“ in der Politik ab, wenn es heißt, „wir sitzen alle im selben Boot“. Was bei Corona nicht galt, gilt umso weniger im Krieg. Die gleichen Politiker und Promis, die nach härteren Maßnahmen schrien und zugleich ungeniert und öffentlich gegen sie verstießen, diese Politiker und Promis sind, wie Schmitt aufzeigt, die gleichen Couch-Generäle, die das imaginierte „Wir“ auf den Krieg und Militarismus einschwören, während sie selbst nie auch nur in die Nähe der Front kommen.
Der Beitrag könnte so rund sein, würde Schmitt es nur wagen, nachdem er schon einen Fuß neben den Holzweg gesetzt hat, konsequent diesen Holzweg gänzlich zu verlassen und gedankliches Sperrgebiet zu betreten.
Aber hier kommt dann die „Line of no return“. Ob Schmitt und Pichl das wissen? Jedenfalls können sich die Autoren beim besten Willen nicht mehr mit Unwissenheit herausreden. Während in diesem Buch vielfach mit den Mythen einer eingebläuten, falschen Selbst-Schuld aufgeräumt wird, gibt es in Bezug auf dieses Wissen eine reale Schuld, und zwar die Holschuld! Wissen ist eine Holschuld. Das gilt insbesondere dann, wenn das Wissen nicht versteckt oder anderweitig im Dunklen verborgen liegt, sondern der Öffentlichkeit barrierelos zugänglich ist.
Dieses Buch erschien im Herbst 2024. Die RKI-Protokolle sind unlängst veröffentlicht worden und haben von dem offiziellen Corona-Narrativ — Nutzen von Lockdowns und Masken, Kontaktbeschränkungen, Aussagekraft der PCR-Test, Wirkung und Sicherheit der „Impfungen“ — nichts als verbrannte Erde hinterlassen. Nicht unerwähnt bleiben dürfen die schon seit über einem Jahr freigeklagten Pfizer-Files, die noch tiefer in das globale Corona-Verbrechen blicken lassen. Die anfänglich als Verschwörungstheorie verschriene Laborthese bestreitet heute niemand mehr. Und obwohl das Corona-Narrativ in Trümmern liegt, wird es von den Autoren, die es besser wissen könnten, behandelt, als stünde das Gerüst unverändert stabil auf seinen Sockeln.
Klima minus Schuld
In nichtchronologischer Reihenfolge las ich die Anthologie. Sebastian Friedrichs Beitrag über das Klima schob ich, nach Pichls und Schmitts Beiträgen Böses ahnend, nach hinten hinaus und wurde mehr als positiv überrascht! Zwar hinterfragt er nicht das von der globalen Green-Economy-Oligarchie und den ihr angeschlossenen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Internationalen Organisationen (IOs) und Meinungsmachtkonglomeraten verbreitete Narrativ des menschengemachten und auf CO2-basierenden Klimawandels — er räumt jedoch gründlich mit den damit verbundenen Selbstschuld-Mythen auf und zieht so dieser Erzählung den schärfsten Zahn. Und das verdient großes Lob!
Zugegebenermaßen ist es beim CO2-basierten, menschengemachten Klimawandel-Narrativ schwieriger, das Wissen darum, dass es konstruiert ist, einzuholen, da es auf diesem Themenfeld nicht die wenigen, aber alles entlarvenden Leaks gibt, die das Narrativ Lügen strafen. Am ehesten eignet sich hierbei der Verweis auf den evidenten Wissenschaftsbetrug bei der bekannten John-Cook-Metastudie, die der einzige und zugleich tönerne Fuß des viel beschworenen „Wissenschaftlichen Konsens zum menschengemacht Klimawandel“ ist (1). Hinzu kommt, dass dieses Narrativ seit der Veröffentlichung des „The Limits of Growth“-Reports des Rockefeller Club of Rome im Jahr 1972 so schleichend und subliminal in das kollektive Bewusstsein eingeträufelt wurde, dass sein Wahrheitsgehalt für viele so selbstverständlich ist wie für den Fisch das Wasser.
Zugleich bedürfte es hierbei nur ein klein wenig gesunden Menschenverstandes, um die Doppelzüngigkeit, Widersprüchlichkeit, Inkohärenz, Ideologie-Durchtränktheit und die wirtschaftlichen Interessenkonflikte bei diesem Narrativ zu erkennen, ebenso wie die realökologischen Schäden der vermeintlichen Heilsversprechen und auch die Tatsache, dass in der Vergangenheit prophezeite Klima-Apokalypsen nicht eingetreten sind.
Wenngleich Friedrich den Grundsatz nicht antastet — immerhin spricht er von Klima und Umweltzerstörung —, arbeitet er sich doch akkurat und analytisch geistesscharf an dem Eigenschuld-Narrativ ab. Dabei differenziert er zwischen zwei Arten der eingetrichterten Schuld: der Konsumschuld und der Existenzschuld. Erstere enttarnt er anhand konkreter Beispiele als eine Schuld-Abwälzung der Hauptverantwortlichen — die Industrien beziehungsweise das ökonomische System als solches — auf die einzelnen Konsumenten. Dieses solcherart gesponnene Narrativ vermittelt dem Individuum, die Rettung des Planeten sei eine Sache der individuellen Verhaltensänderung, während das große Ganze unangetastet bleibt.
Analog verhält es sich zum zweiten Schuld-Mythos, der Existenzschuld, wonach der Mensch als Zerstörer der Erde Träger einer Ursünde sei, die nur noch durch Reduktion oder gänzliche Auslöschung der eigenen Artgenossen abgetragen werden könne.
Bekannteste Ausdrucksform dieser Schuldzuschreibung sind die Geburtenstreiks von Frauen, die dem Irrglauben anheimfallen, Babys seien größere „Klimasünder“ als Flugzeuge oder Militärgerät.
Auch stehen ökologische Endzeitsekten musterbeispielhaft für diesen Schuldglauben. Hier wird ebenfalls die Verantwortung individualisiert, anstatt das große Ganze zu adressieren. Friedrich adressiert das große Ganze, nämlich das ökonomische System, welches die Verwerfungen in erster Linie zu verantworten hat. Dabei betont er im gleichen Atemzug, dass das ökonomische System als Hauptschuldiger seine Schuld nicht durch Green-Washing abtragen kann, während untergründig die Strukturen gleichbleiben. Dass er einer Green Economy als Pseudolösung nicht das Wort redet, ist bedeutsam.
Er bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt:
„Wenn die Frage nach der Systemschuld nicht stehenbleibt bei einer Kritik des Wachstums, sondern die Grundprinzipien des gesamten Gesellschaftssystems infrage stellt, steht sie in Kontrast zu Konsum- und Existenzschuld. Denn dann macht sie deutlich, dass der eigentliche Konflikt nicht zwischen Mensch und Natur besteht, sondern zwischen dem derzeitigen Gesellschaftssystem und den Möglichkeiten einer nachhaltigen Reproduktion von Mensch und Natur. (…) Bedeutender, als sich in Fragen der persönlichen Lebensführung zu verlieren, wäre es also, womöglich gemeinsam, die Systemschuld zu erkennen und die systembedingten Voraussetzungen der Naturzerstörung ins Visier zu nehmen. Diese Voraussetzungen zu verändern, mag sicherlich weitaus schwerer sein, als ein paar Verhaltensänderungen vorzunehmen. Eines wäre es aber in jedem Fall: nachhaltiger“ (Seiten 192 folgende).
Fazit
Aladin El-Mafaalani bringt in seinem Beitrag über soziale Ungleichheit den Kerngedanken, der alle Beiträge der Anthologie verbindet, gut auf den Punkt:
„(D)ie negative Betroffenheit und die persönlich verantwortbare Verursachung bekommen im Kontext der sprachlichen Figur ‚selbst schuld‘ eine spannende Drehung, weil mit ‚selbst schuld‘ gemeint wird, dass man negativ betroffen von einer persönlich zurechenbaren Handlung ist, für die man selbst ursächlich verantwortbar gemacht wird. Diese Selbstschuld ist durchaus möglich. Allerdings ist sie ein relativ unwahrscheinlicher Fall, denn sie unterstellt zum einen, dass eine andere persönliche Handlung möglich gewesen wäre, zum anderen, dass diese Handlungsalternative zu einer besseren Position/Situation für die handelnde Person geführt hätte, und zum Dritten, dass all das in der eigenen Macht lag und man entsprechend die Verantwortung trägt. Das ist ausgesprochen weitreichend, denn man muss zunächst einmal die Fähigkeit besitzen, ganz bestimmte Ziele zu erreichen, insbesondere: den Befund, für den man ‚selbst schuld‘ sei, abzuwenden.“ (Seiten 86 folgende).
Auf ihren jeweiligen Themengebieten drücken die dreizehn Autoren den Hals des ideologischen Trichters zu, über welchen den Menschen eingegeben wird, sie sei seien an diesem und jenem „selbst schuld“. Über weite Teile gelingt dies gut bis grandios. Der Mythos der — alleinigen — Selbstschuld wird aus vielen, thematisch abwechslungsreichen Blickwinkeln betrachtet und dekonstruiert. Dieses Buch kommt genau richtig in Zeiten von meritokratischen Demagogen, zynischen Gaslighting-Diskursen und den großen Agenden, die systemische Verwerfungen sozialisieren, das heißt dem Einzelindividuum anlasten.
Doch genau bei diesen großen Agenden hat das Sammelwerk, genauer gesagt: haben dessen Autoren und Mitherausgeber ihre Schwächen. Denn der angenommene Wahrheitsgehalt des Kernnarrativs, welches den Agenden — Klimawandel, Corona et cetera — zugrunde liegt, werden als unantastbare Axiome betrachtet. Während es noch zu verkraften ist, dass der Klimaschwindel unangetastet bleibt, weil die damit verbundene Schuld-Erzählung gut ausgearbeitet wird, nimmt es sich aber umso tragischer bei Corona aus. Das ist ein Jammer! Einige der Autoren könnten, doch sie tun es nicht. Es sind eben nicht Denkschwächen, mangelnder Intellekt oder analytisches Unvermögen, was manche der Verfasser davon abhält, den Elefanten im Raum zu benennen und wagemutig ideologische Holzwege zu verlassen.
Nein, Corona ist in erster Linie kein Intelligenztest, sondern für Menschen der Öffentlichkeit ein Gradmesser dafür, wie sie in das System und die daran angeschlossene Bewusstseinsindustrie eingebettet sind. Das Corona- und Klimawandel-Narrativ mitsamt der damit verbundenen „Selbst schuld“-Implikationen zu durchblicken, ist nicht geistig schwierig, sondern stellt auf der Ebene von Integrität und Rückgrat zeigen eine Schwierigkeit dar.
Diese Narrative infrage zu stellen, ist gleichbedeutend mit einer Demarkationslinie. Sie ist die Grenze, die das von Chomsky zitierte „Spektrum der akzeptablen Meinungen“ von den „geistigen Sperrgebieten“ (Rainer Mausfeld) trennt, die im Mainstream zuverlässig als „Verschwörungsideologie“ und damit als nicht diskutierbar deklariert werden.
Würden die Autoren in diese Gefilde vordringen, dann würde sich die Überschüttung mit Preisen einstellen, die wir den Autorenbeschreibungen am Buchende entnehmen können. Wenn die besprochenen Behauptungen angetastet würden, dann stünden die Ideologiekritiker mit einem Male wirklich allein auf weiter Flur, während sich ihre Karriereleitern pulverisieren und der Olymp der Hofintellektuellen in unerreichbare Ferne rücken würde.
Upton Sinclair erkannte seinerzeit schon sehr treffend:
„Es ist schwierig, einen Menschen dazu zu bringen, eine Sache zu verstehen, wenn sein Gehalt davon abhängt, daß er sie nicht versteht.“
Insofern ist das Werk auf einer Metaebene eine Sichtbarmachung von Grenzverläufen des Sagbaren. Es gibt den Winkelgrad an, in welchem sich Intellektuelle aus dem Fenster lehnen dürfen und ab wo sie besser innehalten, um nicht aus dem Mainstream herauszufallen, der ihnen das finanzielle und reputierliche Überleben sichert.
Dabei stellt sich folgende Abschlussfrage: Sind Menschen — gerade Intellektuelle —, die das nicht sehen, was sie eigentlich nicht nicht sehen können, aber eben nicht sehen wollen — sind diese Menschen „selbst schuld“?
Hier können Sie das Buch bestellen: „Selbst Schuld!“